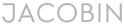Hier können sie sich den ersten Kurzdokumentarfilm der Progressiven Internationale über “black lives” im Mittelmeer anschauen. Er befasst sich mit den Wurzeln und Realitäten der Migrationskrise und zeigt Nanjala Nyabola, Asad Rehman (War on Want), Mattea Weihe (Sea-Watch) und Hassan Zakaria, der selbst die Reise über das Mittelmeer gewagt hat.
Die See im Ärmelkanal ist rau. In der vergangenen Woche begab sich Abdulfatah Hamdallah mit einem behelfsmäßigen Boot in den Kanal. Er könnte 28, 22 oder auch nur 16 Jahre alt gewesen sein–die Angaben dazu sind sehr unterschiedlich. Er hatte einen weiten Weg aus dem Sudan zurückgelegt. Am Abend vor seiner Abreise nach Großbritannien sagte er Freunden, dass er sie vielleicht nicht mehr wieder sehen würde. Seine Leiche wurde am nächsten Tag an die französische Küste gespült; er starb weit weg von seiner Familie, sein Boot konnte ihn nicht sicher über das Meer bringen–und niemand kam ihm zu Hilfe. Bei der Überwachung des Gewässers, in dem er ertrank, dürften die Beamten in den britischen Militärflugzeugen und auf britischen Marineschiffen vermutlich gefeiert haben: So kommt man dem erklärten Ziel der Regierung, die Überfahrt möglichst "unrentabel" zu machen, näher.
Krisen bieten oft auch Möglichkeiten: Im März nahm das Vereinigte Königreich die Coronavirus-Pandemie zum Vorwand, um sein Programm zur Umsiedlung von geflüchteten Menschen auszusetzen. Heute sind die Pubs wieder geöffnet, aber die Umsiedlungen wurden nicht wieder aufgenommen–und die Regierung hat auch keinerlei Hinweise darauf gegeben, wann das wieder der Fall sein könnte. Für Asylsuchende, die versuchen, das Vereinigte Königreich zu erreichen, gibt es derzeit somit keine Alternative zum Seeweg auf eigene Faust.
Rund 5.000 Geflüchtete haben in diesem Jahr den gefährlichen Gewässern des Kanals getrotzt. Diese Zahl ist relativ gering im Vergleich zu den 16.000 Menschen, die Italien im vergangenen Jahr auf dem Seeweg erreichten, oder den 700.000 Menschen, die jährlich ins Vereinigte Königreich einwandern. Nun reden wir aber von Menschen mit wenig Optionen und ohne Macht. Und so begrüßt Großbritannien sie mit Flugzeugen der Royal Air Force, uniformierten Männern und der Drohung, die Marine zu entsenden. Einige dieser Geflüchteten sind vor der von London verursachten Zerstörung im Irak oder in Afghanistan geflohen. Das Vereinigte Königreich lässt nicht zu, dass sie zur Ruhe kommen könnten.
Festung Europa
Warum geschieht das gerade jetzt? Migrationsfeindliche Politik ist in Großbritannien schließlich nichts Neues. Doch wo das Vereinigte Königreich sich bisher auf die EU verlassen konnte, um die schmutzige Arbeit zu tun, Migrantinnen fernzuhalten, wirft der Brexit jetzt neue Probleme auf. Das Vereinigte Königreich wird nicht länger der Nutznießer der Infrastruktur der EU-Außengrenzen sein. Es wird auch nicht mehr in den Genuss der "Vorteile" der EU-Asylpolitik kommen, wie etwa der Dublin-Protokolle, die Migrant\innen dazu zwingen, im ersten EU-Mitgliedstaat, den sie erreichen, Asyl zu beantragen. Bisher hatte diese Politik effektiv dafür gesorgt, dass Menschen, die es über die europäische Mittelmeergrenze schaffen, niemals zum Problem Londons werden konnten. Nun steht das Vereinigte Königreich vor der Herausforderung, einen eigenen unabhängigen Apparat aufzubauen, um Migrant*innen an der Grenze aufzuhalten. Angesichts des Zeitdrucks hat sich die britische Regierung bisher dazu entschlossen, das EU-Grenzregime in kleinerem Maßstab zu kopieren–aber mit ebenso beherzter Grausamkeit.
Seit Jahren–und insbesondere seit dem Arabischen Frühling–hat die EU ihre Grenzpolitik danach ausgerichtet, Menschen, die Sicherheit in Europa suchen, eher abzuschrecken als sie willkommen zu heißen. Die "Sicherheit" an Europas Grenzen beruht seit langem auf Gewalt gegen diejenigen, die europäischen Schutz suchen. Die "europäische Solidarität" in Bezug auf Migration wurde im Sommer 2015 viel diskutiert, als die europäischen Staats- und Regierungschefs kurzzeitig die Sprache des humanitären Mitgefühls für Geflüchtete für sich entdeckten. In der Praxis bestand diese "Solidarität" aber in erster Linie darin, dass die EU-Mitgliedsstaaten ihre Grenzverteidigungskräfte zusammenschlossen, um diese deutlich zu stärken. Weit entfernt von Dover patrouilliert die Grenzflotte der EU, Frontex, im Mittelmeer und in der Ägäis und versucht, die "Festung Europa" gegen Migrant*innen abzuschotten. Wenn es diese EU nicht schon gäbe, dann würden Rassist*innen sie erfinden.
In letzter Zeit stützt sich die EU-Grenzpolitik auch auf neokoloniale Abkommen mit Nachbarstaaten, die dafür bezahlt werden, als europäische Grenzschützer aufzutreten. In der Ägäis-Region sorgte das sogenannte Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei im Jahr 2016 dafür, dass Geflüchtete, die den Grenzübertritt nach Griechenland wagen wollten, von türkischen Grenztruppen abgefangen und in die Türkei zurückgeschickt wurden. Im zentralen Mittelmeerraum wurden im Rahmen des Abkommens zwischen Italien und Libyen im Jahr 2017 EU-Mittel verwendet, um libysche Milizen in "Küstenwachen" umzuwandeln: Migrant*innen, die versuchten, Italien zu erreichen, werden abgefangen und in Gefangenenlager zurückgebracht, wo ihnen Folter, Vergewaltigung, Erpressung und oft auch der Tod durch ihre Bewacher drohen.
Die EU-Politik reagiert auf diese illegalen Handlungen mit einem Achselzucken. Im zentralen Mittelmeer werden Migrant*innen in kaum seetüchtigen Booten derweil nicht gerettet, sondern ignoriert oder eingeschüchtert, manchmal sogar ertränkt. EQW ist nicht weniger als die routinemäßige Verletzung des internationalen Seerechts und der Pflicht, in Seenot geratenen Menschen zu helfen. Die zunehmende Militarisierung der Migrationspolitik–und die Behandlung von Geflüchteten, die ein Recht auf völkerrechtlichen Schutz haben, als feindliche Bedrohung, die also wegen ihres Sicherheitsbedürfnisses bestraft und zurückgedrängt werden "müssen"–verstößt gegen den wichtigsten Grundsatz der Flüchtlingskonvention: dem Prinzip der Nichtzurückweisung (“Non-refoulement” auf Englisch). Der Schutz von Geflüchteten beruht auf dieser Klausel. Und er wird gebrochen, in der Ägäis wie im Ärmelkanal. Die Drohung des Vereinigten Königreichs, Pushbacks durchzuführen und Menschen in Seenot zu schikanieren, ist also Teil eines europäischen Phänomens mit überaus fragwürdiger Legalität–während die europäischen Staats- und Regierungschefs dem Rest der Welt Menschenrechte und "Rechtsstaatlichkeit" predigen.
Festung Großbritannien
Die EU-Mitgliedschaft erlaubte lange Zeit eine Art Arbeitsteilung, bei der der britische Staat Geflüchtete bei ihrer Ankunft in Großbritannien polizeilich überwachte und einkasernierte, während die EU die meisten von ihnen ohnehin an den Außengrenzen in Schach hielt. Der größte Teil der von mehreren britischen Regierungen entworfenen Architektur der migrantenfeindlichen Gewalt konzentrierte sich darauf, Geflüchtete im Vereinigten Königreich absichtlich ins Elend zu treiben, indem man ihnen das Recht auf Arbeit verweigerte, wie es die Regierung von Tony Blair mit mutwilliger rassistischer Grausamkeit tat. Indes wurden viele Asylsuchende ohne Gerichtsverfahren in überfüllten Gefängnissen inhaftiert. Das Vereinigte Königreich musste Migrant*innen also nicht mit seiner militärischen Macht von den eigenen Küsten zurückdrängen. Jetzt muss sich der Staat auf Erfahrungen aus der Zeit vor der EU stützen. In der SendungBBC Todaysorgte kürzlich ein Admiral für besonders beschämende Aussagen: Er erinnerte an Vorfälle, in denen jüdische Holocaust-Geflüchtete auf See festgehalten und dann auf Zypern inhaftiert wurden. Das, so seine Ansicht, könne auch jetzt ein Modell für die britische Politik werden. So sind sie, die Beamten, die die Streitkräfte des britischen Staates leiten.
Wenn die gegenwärtigen Versuche Londons, die Festung Europa zu imitieren, noch unvollkommen erscheinen und das Ergebnis alles andere als erfolgreich ist, dann aus zweierlei Gründen. Erstens: Während es der EU gelingt, ihre Außengrenzen zu sichern, indem sie Nachbarstaaten in ideale Söldner verwandelt (wenn sie gefügig sind) und in die idealen Schurkenstaaten (wenn sie es nicht sind), stehen sich in der Konfrontation zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich beim Thema Ärmelkanal zwei europäische (also "zivilisierte", "demokratische") Nationen gegenüber. Das ist also eine eher unangenehme Situation. Zweitens: Während die Substanz der neuen britischen Grenzpolitik die Maßnahmen der EU widerspiegelt, fehlt der britischen Führung nach wie vor die Expertise der EU, seine brutalen und illegalen Praktiken in eine Art humanitäre Sache zu verwandeln: zum Beispiel die "Rettung" glückloser Geflüchteter vor rücksichtslosen Menschenhändlern. Paradoxerweise bietet uns das Vereinigte Königreich somit ein besseres Bild der tatsächlichen EU-Migrationspolitik, ohne die rhetorischen Filter.
Welche Form des Antirassismus?
Obwohl sie ab und an als "progressive Bastion" verklärt wird, stellt die EU vor allem die vereinte Kraft der alten Kolonialmächte dar. Diese Kraft ist besonders reformfeindlich und wird gegen die Armen an der europäischen Peripherie, gegen afrikanische Bäuer*innen, gegen Migrant*innen aus den ehemaligen Herrschaftsgebieten Europas sowie Geflüchtete aufgrund der aktuellen imperialen Unternehmungen eingesetzt. Antirassistinnen sollten sich davon distanzieren. Die Notwendigkeit einer Politik des eindeutigen Internationalismus ist größer denn je: Eine Politik, die den kontinentalen Chauvinismus der EU ablehnt und Freizügigkeit für alle statt nationalistische Mythen fördert und fordert. Ebenso notwendig ist eine antirassistische Bewegung jenseits des liberalen Humanitarismus, in dem zwar von der Not Geflüchteter gesprochen wird (also hilflose und hilfsbedürftige Geflüchtete, niemals böse und keine Hilfe verdienende "Wirtschaftsflüchtlinge"), aber deren Kämpfe nie mit dem Kampf der Europäerinnen um ein lebenswerteres Leben in Verbindung gebracht werden.
Boris Johnsons Regierung schürt aktuell die Angst vor winzigen Booten im Ärmelkanal und hofft, die britische Öffentlichkeit davon überzeugen zu können, dass die Bedrohung ihrer Sicherheit von ein paar hundert Geflüchteten ausgeht, die auf der Suche nach eigener Sicherheit alles riskieren. Dass die Johnson-Regierung offenbar bereit ist, die eigene Bevölkerung angesichts der grassierenden Pandemie und der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Folgen zu opfern, wird hingegen nicht angesprochen.
Es gibt tausende Unterschiede zwischen der Lebensrealität der Migrant*innen und der Lebensrealität der Europäer*innen und somit tausende Gründe, warum Solidarität oft nicht intuitiv funktioniert. Aber es gibt auch Anknüpfungspunkte angesichts der gemeinsam erfahrenen Verwundbarkeit: In Pflegeheimen und am Arbeitsplatz ist ein Pass heute keine unumstößliche Garantie mehr dafür, dass Politiker*innen das eigene Leben nicht als austauschbar behandeln. Das Leben–und zwar ein anständiges–ist somit etwas, nach dem wir alle streben, und das plötzlich erschreckend schwer erreichbar zu sein scheint.
Chloe Haralambous ist Mitglied von Sea-Watch und hat an mehreren Rettungsaktionen im Mittelmeer teilgenommen. Sie ist außerdem Ko-Gründerin des Mosaik Support Center for Refugees and Locals auf der griechischen Insel Lesbos. Sie ist Doktorandin an der Columbia University.
Barnaby Raine ist Doktorand an der Colombia University.