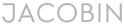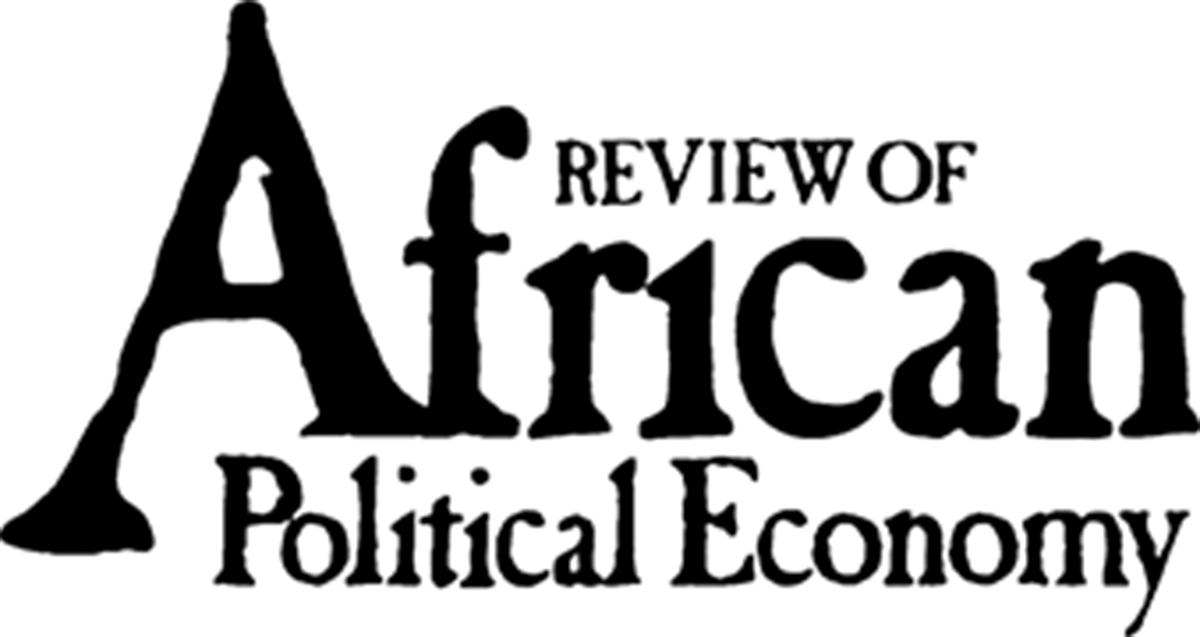Nach über zehn Jahren lockerer Geldpolitik, in der es das erklärte Ziel war, möglichst viel Geld in die Märkte zu lenken, die Liquidität zu steigern und die Inflation zu erhöhen, wird aktuell auf eine restriktive Geldpolitik umgeschwenkt. Geld wird also aktiv aus den Märkten gezogen, um die Inflation zu bekämpfen.
Befürwortende dieser Maßnahmen unterschlagen dabei, dass andere wirtschaftspolitische Instrumente, wie umfassende Preisdeckel, die Besteuerung von Unternehmensprofiten und Umverteilungsmaßnahmen zur Inflationsbekämpfung deutlich besser geeignet sind als der aktuelle Fokus auf Geldpolitik.
Es ist in diesem Kontext natürlich wenig verwunderlich, dass außerhalb der Fachpresse kaum darüber gesprochen oder gar gestritten wird, welchen Einfluss geldpolitische Entscheidungen im Globalen Norden auf die Staaten des Globalen Südens haben. Wenn Währungen des Globalen Nordens, insbesondere der US-Dollar, stärker werden – das erklärte Ziel der aktuellen Zentralbankpolitik –, geraten Staaten im Globalen Süden unter Druck, weil ihre Währungen im Verhältnis an Wert verlieren. Das führt bei Staaten die hohe ausländische Staatsschulden haben in der Regel dazu, dass sie diese nicht mehr bedienen können und immer mehr Schulden zu immer schlechteren Bedingungen aufnehmen müssen.
Sofern in diesen Ländern nicht bereits eine neoliberale Regierung an der Macht ist, die freiwillig Gelder für öffentliche Leistungen und Gemeinwesen streicht, werden sie von Internationalen Institutionen dazu gedrängt, Sparmaßnahmen durchzusetzen.
Starke Währung auf Kosten der Armen
Geschichte wiederholt sich niemals eins zu eins, doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Bereits während der Wachstumskrise und hohen Inflation der 1970er strafften Zentralbanken im Globalen Norden die geldpolitischen Zügel. In Lateinamerika (und anderen Teilen des Globalen Südens) führte das zu einer beispiellosen Staatsschuldenkrise, die den Kontinent für fast eine Dekade in eine wirtschaftliche Krise stürzte. Deren Folgen wurden, wie so oft, den lohnabhängigen, indigenen und armutsbetroffenen Gesellschaftsschichten auferlegt.
Die politökonomische Lage von 1979 hat viele Parallelen zu heute. Es gab zwar damals noch kein Covid-19 und imperiale Angriffskriege gingen vor allem von den USA aus, doch die Situation im Globalen Norden war ebenso geprägt von niedrigem Wirtschaftswachstum und hoher Inflation. Das war unter anderem das Ergebnis des Zusammenbruchs des Bretton Woods Systems.
Unter Bretton Woods wurde, neben der Gründung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, die auf die Verschärfung globaler Ungleichheit hinarbeiten, ein System fester Wechselkurse geschaffen. Diese Vereinbarung auf Basis des Goldstandards hatte erheblich zur Stabilisierung der Weltwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg beigetragen. Als Richard Nixon im Jahr 1971 Bretton Woods unter anderem aufgrund einer Rezession im Globalen Norden und Finanzspekulation aufkündigte, wurden die Wechselkurse instabiler und Unmengen renditehungrigen Kapitals auf den Globalen Süden losgelassen.
Viele Staaten Lateinamerikas waren zu der Zeit in einer recht komfortablen wirtschaftlichen Situation. Wechselkursschwankungen lösten zwar gewisse Probleme aus, aber insgesamt waren die Zinsen für Kredite wegen des Überschwungs an Kapital aus dem Globalen Norden günstig – scheinbar gute Bedingungen für Nationalstaaten, deren Regierungen daran arbeiteten, die Industrialisierung voranzutreiben. Vor allem ab 1975 nahmen daher viele Unternehmen, Banken und Regierungen Kredite auf, die ihnen von Banken aus dem Globalen Norden zu vermeintlich guten Konditionen angeboten wurden. Während dieser Periode relativer Stabilität in Lateinamerika wurde die ökonomische Lage in den USA komplizierter.
Ausgelöst durch die Ölkrise, hohen Druck der Währungsspekulanten auf den US-Dollar und daraus entstehendem niedrigem Wirtschaftswachstum waren die Wirtschaftspolitiker in den USA gezwungen, die Geldpolitik zu lockern, da niedriges Wachstum die Stabilität kapitalistischer Wirtschaften gefährdet. Lockere Geldpolitik bedeutete damals eine Senkung der Leitzinsen, damit Unternehmen Kredite aufnehmen, die Wirtschaft mehr produziert, viel exportiert und der Wert des Dollars im Vergleich zu anderen Währungen steigt. Diese Politik hatte jedoch nicht den gewünschten Effekt: Das erhoffte Wirtschaftswachstum blieb aus – aber die Inflation stieg trotzdem.
Präsident Jimmy Carter setzte daraufhin im Jahr 1979 Paul Volcker als Chef der FED ein. Kaum im Amt, hob er sprunghaft und in beispiellosem Ausmaß den Leitzins an. Es passierte, was vorherzusagen war: die Wirtschaft in den USA brach ein und Millionen Menschen wurden in die Arbeitslosigkeit getrieben. Das wäre vermeidbar gewesen, wie wir heute wissen.
Noch deutlich gravierender waren die Folgen in Lateinamerika. Durch die rapide Erhöhung der Leitzinsen stieg der Wert des US-Dollars im Vergleich zu anderen Währungen stark an. Die Kosten für die Tilgung der Schulden, die zum Beispiel Brasilien aufgenommen hatte, explodierten. Nicht nur war die eigene Währung im Verhältnis auf einmal weniger wert, die meisten Kredite waren auch mit flexiblem Zinssatz versehen, der von der Geldpolitik im Globalen Norden direkt abhängig war, und daher sprungartig anstieg.
Ein Staat, der die Tilgung seiner Schulden nicht mehr leisten kann, hat in der Theorie eine Vielzahl von Optionen. So war es in Finanzkrisen vor 1981 gang und gäbe, dass Staaten Kredite schlicht nicht zurückzahlten, wenn es nicht möglich war. Genau dafür entschied sich die mexikanische Regierung im Jahr 1981. An den Finanzmärkten sahen viele nun ihre Rendite in Gefahr, weshalb sich die Bedingungen für die Schuldenaufnahme für die Staaten Lateinamerikas erheblich verschlechterten. Denn diese Krise war anders: Die Summe der Kredite, die an den lateinamerikanischen Kontinent vergeben wurden, war so hoch, dass eine Reihe an Zahlungsausfällen den Zusammenbruch des US-Amerikanischen Bankenwesens hätte bedeuten können.
Die Branche und die US-amerikanische Regierung übten also massiven Druck auf die Regierungen Lateinamerikas aus, die Staatsschulden zurückzuzahlen – notfalls durch neue Schulden, die sie entweder zu ökonomisch miserablen Bedingungen bei US-amerikanischen Großbanken oder zu ökonomisch und politisch miserablen Bedingungen beim Internationalen Währungsfonds aufnehmen sollten. Dieser vergab zwar scheinbar großzügige Notfallkredite, mit denen Schulden getilgt werden konnten. Diese waren aber immer an sogenannte Strukturanpassungsprogramme gekoppelt.
Strukturanpassungsprogramme zwingen einen Staat, die Finanzmärkte für ausländisches Kapital zu öffnen, Sozialausgaben zusammenzustreichen und öffentlichen Besitz an private Unternehmen und Einzelpersonen zu verscherbeln. In dieser Situationen waren viele Staaten Lateinamerikas für mehrere Jahre gefangen. Das hatte so schwerwiegende Folgen für die Bevölkerungen, dass diese Periode in Lateinamerika als verlorene Dekade beschrieben wird. Auch in den USA hatte die durch Volcker beschrittene Politik massive Auswirkungen auf die Bevölkerung. Die unteren Klassen wurden in die Arbeitslosigkeit und die Privatverschuldung getrieben – was bis heute nachwirkt.
Alte Strategie, neue Widerstände
Vieles an der aktuellen Situation erinnert an das Jahr 1979. Wegen des Shutdowns in Reaktion auf die Corona-Pandemie nahmen Staaten weltweit viele Schulden auf, um die Wirtschaft am Laufen zu halten – was viele von ihnen bereits im Nachgang der Finanzkrise von 2007/08 getan hatten. In den zehn größten Ökonomien Lateinamerikas (Venezuela ausgenommen) hat sich das Verhältnis von Staatsschulden zu Wirtschaftsleistung seit 2007 im Schnitt um 22,7 Prozent erhöht. In Deutschland lag die Verschuldung im gleichen Zeitraum bei gerade einmal 3,7 Prozent.
Die Kosten für Staatsschulden in Lateinamerika sind in den letzten zwei Jahren durch die Decke gegangen: Argentinien zahlt inzwischen 21,5 Prozent mehr Zinsen auf Staatsanleihen als Deutschland, Ecuador 46,8 Prozent und Venezuela sogar 89,4 Prozent. Im Schnitt zahlen die zehn größten Ökonomien Lateinamerikas 25,5 Prozent höhere Zinsen als Deutschland – Geld, das entweder durch die Aufnahme neuer Schulden aufgetrieben wird, an anderer Stelle eingespart oder in Form von Steuern aus dem Wirtschaftskreislauf gezogen werden muss.
Die Inflation bewegt sich mit 8,3 Prozent in den USA und 10 Prozent im Euroraum auf einem ähnlich hohen Level wie 1979. Wie auch zu Zeiten des Volcker-Schocks ist das Wirtschaftswachstum in den USA sowie der EU niedrig und auch die Reaktionen der Zentralbanken in den USA und der EU sind mit damals vergleichbar. Die Geldpolitik wird restriktiver. Heute bedeutet das unter anderem die Erhöhung der Leitzinsen. In den letzten zwei Jahren hat die FED die Leitzinsen um 3 Prozent und die EZB um 2 Prozent erhöht.
Doch die Welt stand die letzten vierzig Jahre nicht still. Progressive Kräfte des Globalen Südens haben Wege gesucht und gefunden, sich gegen die wirtschaftliche Ausbeutung durch den Globalen Norden zu wehren: Die Verschuldung in Fremdwährung wurde in vielen Staaten gezielt verringert. So liegt sie zum Beispiel in Brasilien nur noch bei 3,3 Prozent, in Mexico bei 22,5 Prozent und in Chile bei 49,6 Prozent – deutlich niedriger als 1979.
Viele Staaten haben Mechanismen entwickelt, um auf schwankende Wechselkurse reagieren zu können. In Lateinamerika haben unter anderem Kolumbien und Chile hohe Reserven an Fremdwährungen aufgebaut, die sie in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenz verkaufen können, um die eigene Währung zu stabilisieren. Zentralbanken in Brasilien, Mexiko, Peru, Chile und Kolumbien haben durch Ankaufprogramme die Finanzmärkte liquide gehalten. Regulierungen für den Finanzsektor wurden vielerorts härter und die Aufsicht in den Zentralbanken gebündelt. Brasilien und Mexiko haben inzwischen direkten Zugriff auf US-Dollar Liquidität von der FED, womit sie Wechselkursschwankungen auffangen können.
Doch seit der Finanzkrise von 2007 werden die Finanzmärkte der Eurozone und des US-Dollars nur noch dadurch stabil gehalten, dass Zentralbanken massiv eingreifen. Sie kaufen Staatsanleihen und andere Werte auf, um Preise und das Schattenbankensystem stabil zu halten.
Zentralbanker und Ökonomen haben in Reaktion auf die Finanzkrise ab 2007, zur Bekämpfung der Staatsschuldenkrise im Euroraum und zuletzt zur Abfederung der Folgen der Covid-19-Pandemie neue Zentralbankinstrumente entwickelt, die sich Stück für Stück normalisiert haben. Zentral waren und sind Anleihekaufprogramme, bei denen Zentralbanken auf den Finanzmärkten vor allem Staatsanleihen, aber auch Anleihen von privaten Unternehmen ankaufen, um Finanzierungskosten stabil zu halten und die Inflation anzuregen. Das passiert in einem derartigem Ausmaß, dass die Bilanz der EZB inzwischen so viel Wert ist, wie ein Drittel des jährlichen wirtschaftlichen Outputs der EU. In den USA sieht es ähnlich aus. Wichtig war und ist es auch, nicht regulierten Finanzakteuren, sogenannten Schattenbanken, Zugang zu kurzfristiger Liquidität zu verschaffen.
Heute warnen Menschen mit wissenschaftlichem Hintergrund, dass über fünfzig Staaten des Globalen Südens kurz davor sind, ihre Schulden nicht mehr bedienen zu können und aktuell zieht die Inflation nicht nur im Globalen Norden, sondern auch in Lateinamerika an. Darauf reagieren die dortigen Zentralbanken mit einer Erhöhung der Leitzinsen. Durch diese Maßnahme soll der Wert der Währung stabilisiert werden – dadurch, dass die Wirtschaft weniger Kredite aufnimmt und dadurch die Inflation gebremst wird. Diese Maßnahmen erreichen oft nicht das erklärte Ziel, bringen aber eine Reihe von Nebenwirkungen mit sich – zum Beispiel eine schrumpfende Wirtschaft. Im Kapitalismus bedeutet das: höhere Arbeitslosigkeit, geringere Staatseinnahmen sowie Sparmaßnahmen im öffentlichen Sektor.
Trotz dieser von Unsicherheit und Instabilität geprägten Situation gehen FED und EZB derzeit extrem riskant vor: Sie fahren die Stabilisierungsprogramme wieder ein und erhöhen zeitgleich die Leitzinsen. Als die FED 2013 nur ankündigte, dass sie die Ankaufprogramme verringern wird, reichte das bereits aus, um die Kosten für Staatsschulden in Lateinamerika durch die Decke gehen zu lassen. Was wir aktuell erleben, ist eine Politik, die die Fehler von 1979 nicht nur wiederholt, sondern auch noch mit den Fehlern von 2013 kombiniert. Wie die genauen Folgen dieser Politik aussehen und ob das Instrumentarium der Zentralbanker und Wirtschaftspolitiker in Staaten des Globalen Südens ausreicht, um mit dem zu erwartenden Schock umzugehen, kann niemand vorhersagen.
Internationale Krisen brauchen internationale Kämpfe
Dieses wirtschaftspolitische Live-Experiment, das von Zentralbankern und neoliberalen Ökonomen vorangetrieben wird, ist in der Geschichte beispiellos. Besonders perfide daran ist, dass Wirtschaftsliberale seit den 1970er Jahren viel Energie darauf verwendet haben, Zentralbankpolitik als eine rein technische Angelegenheit zu verkaufen und sich für die »Unabhängigkeit« von Zentralbanken einzusetzen – mit Erfolg. Heute stehen alle wichtigen Zentralbanken des Globalen Nordens außerhalb jeder parlamentarischen Einflusssphäre. Dass sich daran kurzfristig etwas ändern lässt, ist mehr als unwahrscheinlich. Selbst wenn parlamentarische Vertretende die Risiken der aktuellen Linie erkennen, können sie kurzfristig keine Änderung der Politik erzwingen.
Personen aus aktivistischen Bewegungen und politische Repräsentierende des Globalen Südens, wie Thomas Sankara, kämpften bereits seit dem formellen Ende des Kolonialismus gegen Abhängigkeiten im globalen Finanzsystem. Im Bewusstsein, dass der politische Feind und Auslöser der wirtschaftlichen Krisen, im Globalen Norden sitzt, blockierte die aus dem Globalen Süden initiierte Bewegung Debt for Climate am 14. Oktober dieses Jahres eine gemeinsame Sitzung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington. Am 17. Oktober wurde das Finanzministerium in Berlin besetzt. Die Bewegung fordert einen Schuldenerlass für Staaten des Globalen Südens. Denn die von Finanzakteuren aus dem Globalen Norden geforderten Zahlungen sind nicht legitim, sondern das Erbe eines Machtgefälles, das aus kolonialer Zeit stammt.
Ein Schuldenschnitt ist ein zentraler Schritt, wird neo-koloniale ökonomische Machtverhältnisse allein aber nicht beenden können. Es braucht zusätzlich ein grundsätzliches Umdenken in der Geld- und Wirtschaftspolitik, abseits des technokratischen Status quo. Blinde Geldpolitik taugt zur Bekämpfung wirtschaftlicher Krisen im Globalen Norden nicht, wie die Geschichte gezeigt hat, und sie zieht desaströse Auswirkungen im Globalen Süden nach sich. Das gilt nicht nur in Bezug auf Staatsschulden, sondern auch für Handelsbeziehungen. Fragen der Geldpolitik sind keine technischen, sondern politische Fragen, an denen sich Verteilungskämpfe entscheiden.
Wer die internationalen Wirtschaftsordnung umgestalten will, wird sich in eine harte Auseinandersetzung begeben müssen. Das weiß auch Gustavo Petro, Ministerpräsident Kolumbiens. In einer öffentlichen Ansprache am 19. Oktober wies er auf die bewusste Zerstörung der globalen Ökonomie durch die Geldpolitik der USA hin. Er ruft die Staaten Lateinamerikas dazu auf, einen Plan zu entwickeln, um dem Wirken der USA gemeinsam und entschlossen entgegenzutreten. Die Unterstützung progressiver Bewegungen und politischer Kräfte nicht nur in Brasilien, Bolivien, Chile, Mexico und Peru ist ihm dabei sicher. Hoffen wir, dass die bewährte Parole sich bewahrheitet und das vereinte Volk niemals besiegt werden kann – auch nicht von der Architektur der internationalen Finanzmärkte.
Robin Jaspert studiert Wirtschaftsgeschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Internationale Beziehungen und Internationale Politische Ökonomie. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit engagiert er sich in der politischen Bildung und im Bewegungsaktivismus.