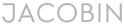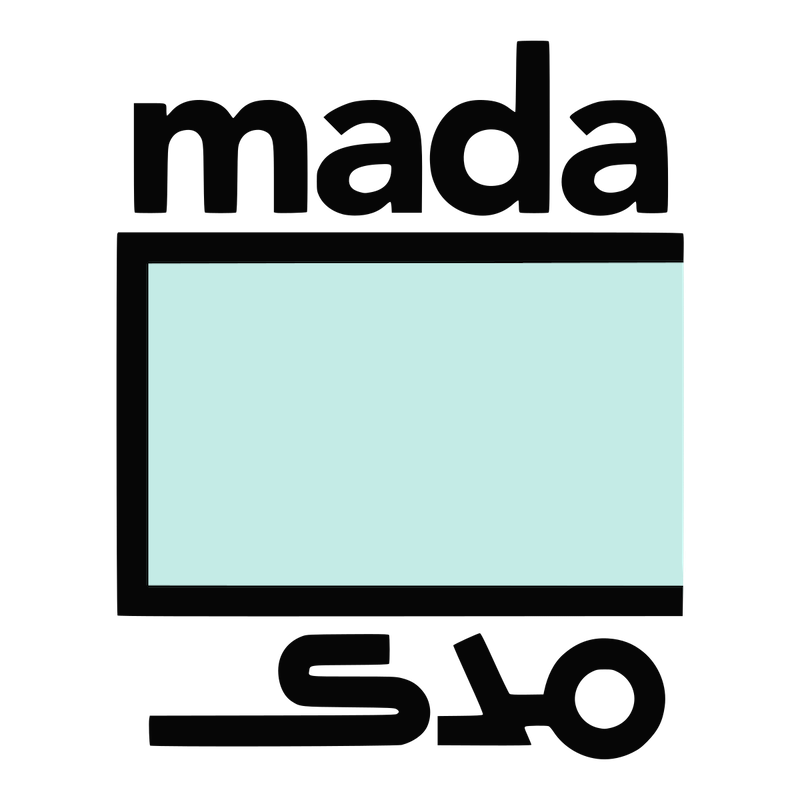Obwohl sie in der israelischen Öffentlichkeit lange Zeit tabuisiert wurden, sind die Ereignisse der Nakba inzwischen eindeutig belegt, oft von israelischen Historikerinnen und Historikern, und stützen sich auf Befunde aus israelischen Archiven. Nach dem offiziellen Ende des britischen Mandats über Palästina am 14. Mai 1948 begannen bewaffnete Milizen wie die Irgun, die Hagana und die Stern-Bande mit Angriffen auf palästinensische Gemeinden, bei denen etwa 15.000 Menschen getötet und fast 500 Städte und Dörfer zerstört wurden. Die Milizen verübten auch Massentötungen wie die Massaker von Tantura und Deir Yassin, um die Menschen einzuschüchtern und sie dazu zu zwingen, ihre Häuser zu verlassen.
Der israelische Historiker Ilan Pappé beschreibt das Vorgehen in seinem BuchDie ethnische Säuberung Palästinas: »Die Befehle gaben detailliert die Einsatzmethoden zur Zwangsräumung vor: groß angelegte Einschüchterungen; Belagerung und Beschuss von Dörfern und Wohngebieten; Niederbrennen der Häuser mit allem Hab und Gut; Vertreibung, Abriss und schließlich Verminung der Trümmer, um eine Rückkehr der vertriebenen Bewohnerinnen und Bewohner zu verhindern.«
Für Millionen von Palästinensern ist die Nakba nicht nur ein historisches Ereignis, sondern anhaltende Realität. Die Beschlagnahme von palästinensischem Land und die Zwangsumsiedlung von Palästinenserinnen sind nach wie vor ein hochaktuelles Thema, wie man an Orten wie Al-Araqib im Negev und Sheikh Jarrah sehen kann, wo palästinensische Bewohner jederzeit von Enteignung und Vertreibung bedroht sind. Angesichts dieser Lage bleibt das Gedenken an die Nakba eine vereinende Kraft, die über Grenzen und Generationen hinweg Palästinenserinnen und Palästinener vereint und als Symbol ihrer gemeinsamen Geschichte und ihres anhaltenden Kampfes für Gerechtigkeit und Selbstbestimmung dient.
Berlin gehört zu den Hunderten von Städten weltweit, in denen regelmäßig Nakba-Demonstrationen stattfinden. Die Hauptstadt beheimatet seit den 1960er Jahren eine große palästinensische Gemeinde, die zunächst aus palästinensischen Studierenden, Geflüchteten aus dem Libanon und politischen Exilanten bestand. Diese Community ist über Generationen hinweg zu einer der größten in Europa angewachsen und zählt heute schätzungsweise 40.000 Menschen. Die Palästinenserinnen und Palästinenser in Berlin bewahren nicht nur ihre Kultur und ihr Erbe, sondern setzen sich auch aktiv für ihre Rechte in Deutschland ein und machen auf ihre Anliegen aufmerksam.
Im vergangenen Jahr hat sich die Atmosphäre in Berlin jedoch verändert. Am 17. April wurden eine Demonstration und zwei Kundgebungen zum Gedenken an die Nakba und zur Solidarität mit palästinensischen politischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen von der Berliner Polizei verboten. Unter Berufung auf den israelkritischen Charakter der Versammlungen und unbekannte Personen, die sich auf pro-palästinensischen Kundgebungen antisemitisch geäußert haben sollen, erklärten die Behörden, das Verbot sei eine Präventivmaßnahme, um die »unmittelbare Gefahr« von antisemitischen und volksverhetzenden Aussagen zu vermeiden. Für die Zehntausenden palästinensischen Menschen in Berlin wirkt es aber so, als ob die Handlungen von einer Handvoll von Personen als Vorwand benutzt werden, um ihnen das Recht auf freie Meinungsäußerung vollständig zu entziehen.
Verbieten und bestrafen
»Sie versuchen alle Veranstaltungen zu verbieten, bei denen es um die Menschenrechte in Palästina geht, unabhängig davon, wer die Veranstaltung organisiert«, so Rechtsanwalt Ahmed Abed gegenüber JACOBIN. »Das Ziel ist es, die Kritik an der israelischen Apartheid und der völkerrechtswidrigen Besatzung zu unterdrücken. Das gilt für die selbst betroffenen Palästinenserinnen und Palästinenser, die hier leben, genauso wie für Menschen, die sich solidarisch erklären. Die Polizei erweckt den Eindruck, dass das Verbot nur ausgesprochen wurde, weil es sich um Palästinenserinnen und Palästinenser handelt.«
Das Verbot ist in der Tat eine von vielen Maßnahmen der Polizei, mit denen Palästinenser und ihre Unterstützerinnen daran gehindert werden sollen, öffentlich zu demonstrieren. Am 15. Mai letzten Jahres wurden alle offiziell angemeldeten Veranstaltungen zum Gedenken an die Nakba kurzfristig verboten. Das Verbot erstreckte sich auf alle Versammlungen mit mehr als zwei Personen und betraf Kundgebungen, Demonstrationen und Mahnwachen, die von der deutsch-palästinensischen Aktivistengruppe Palästina Spricht und Samidoun, dem Solidaritätsnetzwerk palästinensischer politischer Gefangener, sowie von nicht-palästinensischen Organisationen wie der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost organisiert wurden.
Später am Tag beschloss eine Gruppe palästinensischer Aktivistinnen und Aktivisten, auf dem Hermannplatz in Neukölln einen Flashmob gegen das Verbot zu veranstalten. Die Gruppe stand schweigend und ohne Transparente mitten auf dem Hermannplatz, hob ihre Fäuste in die Luft und posierte für ein Gruppenfoto. Spontan versammelten sich weitere Menschen, um ihre Solidarität gegen das Verbot und ihre Unterstützung Palästinas öffentlich zu bekunden.
Die Polizei, die bereits vor Ort war und augenscheinlich auf eine mögliche Aktion wartete, nahm rund 170 Personen, darunter auch einige neugierige Passanten, gewaltsam fest. Von den Festgenommenen wurden 27 zu einer Geldstrafe von jeweils 400 Euro, insgesamt also rund 8.000 Euro, verurteilt. Einige wenige legten vor Gericht Einspruch gegen die Strafbefehle ein, während die meisten den vollen Betrag bezahlten.
»Ich wurde verhaftet, weil ich eine palästinensische Flagge hielt«, erklärt Michael J., ein junger palästinensischer Künstler, der ebenfalls am 15. Mai verhaftet wurde, im Gespräch mit JACOBIN. »Ich war allein und stand an der Seite [der Demonstration]. Die Polizei hielt nach jedem Ausschau, der irgendetwas mit einem palästinensischen Symbol bei sich trug. Es war so etwas wie Racial Profiling, die Polizei konzentrierte sich auf POCs [People of Color, rassistisch diskriminierte Menschen], die sich in der Gegend aufhielten.«
Rechtsanwalt Abed, der auch Michael J. vertritt, sagt, die Polizei habe »in Neukölln jeden, der ein palästinensisches Tuch trug, eine Flagge hielt oder andere palästinensisches Symbol zeigte, angehalten und ihm das Zeigen der Symbole verboten. Viele Personen wurden sogar festgenommen.«
Viele der Aktivistinnen und Aktivisten, die dieser Repression ausgesetzt sind, haben den Eindruck, dass die Verfahren vor allem dazu gedacht sind, sie von künftigen politischen Aktivitäten abzuhalten. Michael J., der gegen seinen Bußgeldbescheid Berufung einlegte, beschrieb das Verfahren vor Gericht als zermürbend und voreingenommen: »Das Gericht schickte mir einen Zahlungsbefehl. Ich legte Einspruch ein, und dann begann mein Prozess. Ich wurde für schuldig befunden. Der Richter war in keiner Weise neutral. Dieser ganze Scheinprozess sollte uns nur zermürben.«
Feindselige Stimmung
Abed ist der Ansicht, das Protestverbot sei verfassungswidrig. Es verstoße gegen Artikel 5 des Grundgesetzes und gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.
»Das Verwaltungsgericht Berlin erklärte das Verbot unter anderem deshalb für rechtmäßig, weil der Versammlungsleiter die israelische Apartheid anprangerte. Das Gericht folgerte daraus, dass eine besondere Gefahr für die öffentliche Sicherheit bestünde«, erklärte er. »Das Oberverwaltungsgericht bestätigte das Verbot zwar, nahm aber diesen Grund zurück. Beide Gerichte stellen sich damit gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die besagt, dass für ein Verbot eine Gefahr vom Anmelder selbst ausgehen muss. Die Polizei Berlin hat jedoch nur Vorfälle beschrieben für die der Anmelder gar nicht selbst verantwortlich war.«
Doch das Demonstrationsverbot ist nur die Spitze des Eisbergs. Inzwischen hat der Berliner Senat damit begonnen, Druck auf Einrichtungen auszuüben, keine weiteren Veranstaltungen über Palästina abzuhalten. Eine anonyme Quelle erklärte gegenüber JACOBIN, dass dieser Druck die Form der direkten oder indirekten Androhung von Mittelkürzungen annimmt.
Am 29. April sollte eine Veranstaltung über antipalästinensischen Rassismus und die Unterdrückung von palästinensischem Aktivismus im Kulturzentrum Oyoun in Neukölln stattfinden, einer gemeinnützigen Einrichtung, die sich selbst als »Raum für kritische Auseinandersetzung, reflektiertes Experimentieren und radikale Solidarität« durch »dekoloniale, queer*feministische und migrantische Blickwinkel« beschreibt. Einige Wochen vor der Veranstaltung wurde den Organisatorinnen und Organisatoren jedoch mitgeteilt, dass die Veranstaltung nicht mehr in der Einrichtung stattfinden könne. Sie wurde später an einem anderen Ort abgehalten und von über 130 Menschen besucht.
Viele Aktivistinnen und Aktivisten in der Stadt halten die indirekte Drohung, Gelder zu entziehen für besorgniserregend, da sie einen Präzedenzfall schafft, der der Stadtverwaltung die Autorität einräumt, zu bestimmen, über welche politischen Anliegen gesprochen werden darf und über welche nicht. Schließlich leben in Berlin viele Diasporagemeinden, deren Heimatregierungen gute Beziehungen zur Berliner Politik pflegen. Wird die Polizei ein ähnliches Verbot gegen die ägyptische Gemeinde verhängen, wenn der ägyptische Machthaber das nächste Mal zu einem Staatsbesuch in der Stadt ist?
Tsafrir Cohen, Geschäftsführer der Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international, sieht die jüngsten Verbote als Teil eines allgemeinen Trends in Deutschland: »Wir beobachten seit Jahren das Schrumpfen der Räume im Zusammenhang mit Israel, Palästina und Antisemitismusvorwürfen. Die Tatsache, dass hier mit Verboten gearbeitet wird, während im Fall der Demonstrationen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, wo die Schoah immer wieder verharmlost wurde, dies nicht der Fall war, spricht Bände.«
In seinen Augen benutzt der Staat Antisemitismus als Vorwand, um verstärkte polizeiliche Repressionen zu normalisieren: »Die Gefahr in dem Zusammenhang ist, dass die Debatte um Israel und Antisemitismus für Sicherheitspolitiker:innen und -organe lediglich als ein willkommenes Einfallstor für die Etablierung repressiver Praktiken und Maßnahmenpakete dienen wird, die dann freilich nicht mehr nur für diesen Themenkomplex reserviert bleiben, sondern allgemeiner Anwendung finden werden. Ich warne ausdrücklich: Eine solche Politik wird die Bundesrepublik in eine illiberale Richtung führen, wie wir sie in Polen oder Ungarn kennen.«
Gespaltene Linke und schweigende Zivilgesellschaft
Die ehemalige Abgeordnete der LINKEN im Bundestag Christine Buchholz war am 15. Mai vergangen Jahres ebenfalls auf dem Hermannplatz. Am 22. März 2023 wurde sie wegen ihrer Teilnahme an der Nakba-Demonstration vor Gericht gestellt. Ihr zweiter Gerichtstermin war für Ende April angesetzt, wurde aber verschoben. Sie bezeichnet das Verfahren als »überzogen« und sagt: »Der Skandal ist nicht, dass wir nicht zahlen wollen. Der Skandal ist das Demoverbot und der Polizeikessel, in dem wir für bis zu zwei Stunden festgehalten wurden.«
Abed, der auch Parteimitglied ist und Buchholz vor Gericht verteidigt, sagt, DIE LINKE habe sich klar gegen das Verbot positioniert. Auch der innenpolitische Sprecher des Berliner Landesverbandes Niklas Schrader und der Berliner Abgeordnete Ferat Kocak hätten das Verbot kritisiert, so Buchholz: »Das ist schon mal gut, aber mehr Widerspruch täte Not.«
In der Tat teilt nicht jeder in der Linkspartei ihre Position. Die Partei war schließlich an der Berliner Stadtregierung beteiligt, die das Verbot verhängte, und Klaus Lederer – damals stellvertretender Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa – hat die palästinensische Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) mehrfach als »strukturell antisemitisch« bezeichnet. Erst im vergangenen Jahr wurde dem parteinahen Jugendverband in Berlin die Finanzierung entzogen, nachdem er eine Resolution verabschiedet hatte, die Israel als »Apartheidstaat« bezeichnete. Lena Kreck, von Dezember 2021 bis April 2023 Senatorin für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung in der Berliner Landesregierung für DIE LINKE, äußerte sich damals nicht zu den Verboten.
Zivilgesellschaftliche Stimmen wirken in der Frage ähnlich gespalten – oder schlicht zu eingeschüchtert, um sich überhaupt zu äußern. Sowohl das in Berlin ansässige European Center for Constitutional and Human Rights, das Whistleblower wie Julian Assange und Edward Snowden energisch verteidigt, als auch der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein, der linken Aktivisten, die von staatlicher Verfolgung bedroht sind, kostenlose Rechtshilfe anbietet, wollten die Verbote auf Nachfrage von JACOBIN nicht kommentieren.
2019 verabschiedete der Bundestag einen Antrag mit dem Namen »BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen«, der sich auf die umstrittene Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) stützt. Laut Buchholz hat dieser Schritt »die Kriminalisierung und Diffamierung der Palästina-Solidarität nochmal massiv angefacht«. Die IHRA-Definition wird dafür kritisiert, dass sie Kritik am Zionismus als Staatsideologie mit Antisemitismus als solchem gleichsetzt, und wird von einigen Gruppen als Instrument beschrieben, um Debatten über die Unterdrückung von Palästinenserinnen und Palästinensern zu unterbinden.
In der Tat wurden seit der Verabschiedung des Antrags mehrere Vorfälle gemeldet, bei denen Palästinenserinnen und Palästinenser von Konferenzen ausgeladen oder ihnen der Zugang zu öffentlichen Räumen verweigert wurde. Im Februar 2022 wurden sechs arabische Journalisten von der Deutschen Welle wegen angeblichem Antisemitismus entlassen. Zwei der Betroffenen, Farah Maraqa und Maram Salem, beschlossen, die rechtswidrige Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses anzufechten, und zogen gegen die DW vor Gericht. Ihre Entlassung wurde vom Arbeitsgericht für rechtswidrig erklärt.
Später, am 26. April 2022, entschied das Landgericht Stuttgart, dass die Versuche der Landesbank Baden-Württemberg, Bankkonten des Stuttgarter Palästina-Komitees zu schließen, ebenfalls rechtswidrig waren. Zur Begründung ihrer Entscheidung berief sich die Bank auf den Anti-BDS-Beschluss des Deutschen Bundestages. Für Buchholz und andere könnte die Doppelmoral nicht offensichtlicher sein.
Wer beschützt wen?
Es ist wenig überraschend, dass die öffentliche Debatte zum Thema Israel-Palästina in Deutschland – dem Land, das eine singuläre historische Verantwortung für die Ermordung von über 6 Millionen europäischen Jüdinnen und Juden trägt – anders aussieht als im Rest der Welt. Doch die zunehmende Repression palästinensischer Stimmen und ihrer Unterstützer wirkt zunehmend, als würde der deutsche Staat seine offizielle außenpolitische Haltung denjenigen Gruppen aufzwingen, die am stärksten von ihr betroffen sind.
In einem offenen Brief, der am 21. April veröffentlicht wurde, sprachen sich hundert in Berlin lebende Juden und Israelis gegen das Verbot aus und erklärten: »Dieses pauschale Verbot […] das auf Spekulationen über mögliche rechtswidrige Handlungen beruht, sehen wir als diskriminierend gegenüber der palästinensischen Minderheit in Deutschland und als besorgniserregenden Präzedenzfall, der unweigerlich auch andere marginalisierte Communities betreffen wird.«
Yossi Bartal, Journalist, Schriftsteller und Mitglied der Diaspora Alliance, einer Organisation, die sich der Bekämpfung von Antisemitismus und den Werten einer multikulturellen Demokratie verschreibt, gehörte zu den Unterzeichnern des Briefes. Gegenüber JACOBIN kritisiert er den Umgang des Senats mit dem Schreiben: »Der Brief wurde an Innenministerin Iris Spranger (SPD) geschickt, und nach meiner Kenntnis gibt es immer noch keine Antwort. Wir machen den Behörden klar, dass sie uns nicht als Werkzeug benutzen sollten, um ihre autoritären Ambitionen durchzusetzen.«
Welche Absichten haben die Behörden bei ihrem Vorgehen? Bartal glaubt nicht, dass es dabei um die Bekämpfung von Antisemitismus geht: »In der Vergangenheit waren bereits viele Demonstrationen in Berlin Ort von Aktionen oder Aussagen, die den Wünschen der Organisatoren zuwiderliefen. Ein Verbot von Demonstrationen ist keine Lösung. Palästinensische Demonstrationen gesondert zu behandeln, sendet eine sehr beunruhigende Botschaft.«
»Das Verbot von palästinensischen Demonstrationen hat nichts mit dem Schutz der Juden in der Stadt zu tun. Palästinenser daran zu hindern, ihr Recht auf Protest auszuüben, dient nicht dem Schutz von irgendjemandem, geschweige denn von Juden«, fährt er fort. »Stattdessen wird damit ein System aufrechterhalten, das sich gegen eine der verletzlichsten und marginalisiertesten Gruppen in Deutschland richtet. Zu dieser Gruppe gehören viele staatenlose Menschen, die bereits mit dem System zu kämpfen haben, was sehr besorgniserregend ist.«
Cohen stimmt dem zu: »Gegen antisemitische Hetze und Hassrede insgesamt gibt es Gesetze, die es der Polizei erlauben, betreffende Personen aus einem Demonstrationszug holen und geltendes Recht durchzusetzen. Ist die Polizei als Exekutivorgan nicht auch für genau solche Fälle vor Ort, wenn protestiert wird? Und stünde eine solche Strategie nicht viel mehr im Einklang mit polizeilichen Aufgaben einerseits und der demokratischen Verfasstheit unserer Gesellschaft mit grundgesetzlich garantierten Rechten andererseits? Stattdessen wird in Berlin zum wiederholten Mal wegen des erwarteten Fehlverhaltens Einzelner präventiv und völlig unverhältnismäßig das Grundrecht der Versammlungsfreiheit der Vielen außer Kraft gesetzt.«
Die Versammlungsfreiheit gilt für alle oder gar nicht
Trotz der Repressionen im letzten Jahr bereitet sich die palästinensische Gemeinde in Berlin erneut auf das Nakba-Gedenken in diesem Monat vor. Nakba75, eine Kampagne zur Vorbereitung des Gedenkens, die am 8. März zur Vorbereitung des Gedenkens initiiert wurde, plant eine breite bundesweite Mobilisierung gegen Demonstrationsverbote und gegen antipalästinensischen Rassismus in Deutschland.
In Berlin gibt es auch Pläne für Performances und Kunstausstellungen zum Gedenken an die Nakba. Eine Gruppe palästinensischer Künstlerinnen und Künstler plant derzeit eine Fotoausstellung. Wie schon in der Vergangenheit haben sie jedoch Schwierigkeiten, einen geeigneten Raum zu finden.
Galerien und andere Einrichtungen befürchten, als antisemitisch eingestuft zu werden oder staatliche Mittel zu verlieren. Michael J., der palästinensische Künstler, der seine Geldstrafe vor Gericht angefochten hat, meint gegenüber JACOBIN: »Wir haben Schwierigkeiten, einen Ort für die Ausstellung zu finden. Wir haben Anfragen an eine Reihe von Ausstellungsorten geschickt, aber ohne Erfolg.«
Während der gesamten Vorbereitungen schwebt die drohende Gefahr eines weiteren Verbots über den Köpfen der Aktivistinnen und Aktivisten. Sollte es tatsächlich umgesetzt werden, würde dies darauf hindeuten, dass die Berliner Behörden den palästinensischen Aktivismus in der Stadt langfristig unterbinden wollen. Doch in diesem Fall sollten sie nicht allein gelassen werden. Buchholz meint: »Wir brauchen mehr Solidarität gegen die Verbote. Ich erwarte, dass all die, die sich auch in anderen Zusammenhängen immer klar und deutlich für die Meinungsfreiheit einsetzen, das auch hier tun.«
Bartal von der Diaspora Alliance stimmt ihr zu: »Das Versäumnis der politischen Parteien und offiziellen Institutionen, das Demonstrationsverbot öffentlich anzuprangern, ist besorgniserregend. Wie die Geschichte zeigt, können sich Menschenrechtsverletzungen an einem Ort schnell über ihren ursprünglichen Kontext hinaus ausbreiten. Das heißt, was mit den Palästinensern in Berlin beginnt, endet nicht mit den Palästinensern.«
Außerdem weist er darauf hin, dass »an der letztjährigen Nakba-Demonstration auch jüdische Aktivisten teilnahmen, von denen einige sogar verhaftet wurden. Es wird erwartet, dass dieses Jahr mehr jüdische Aktivisten teilnehmen werden, da sie der Meinung sind, dass ihre Rechte mit denen der Palästinenser verflochten sind.«
Unabhängig von den Gründen für das Verbot stellt die Einschränkung der Meinungsfreiheit einen gefährlichen Präzedenzfall dar und untergräbt die Grundwerte der Demokratie und des offenen Dialogs, die die Bundesrepublik zu verteidigen vorgibt. Das Recht auf freie Meinungsäußerung in Deutschland muss auch für palästinensische Stimmen gelten.
Fidaa Al Zaanin ist eine palästinensische Feministin aus Gaza. Derzeit lebt sie in Berlin und setzt sich für die Gleichstellung der Geschlechter und soziale Gerechtigkeit ein.
Foto: Hossam el-Hamalawy / Flickr