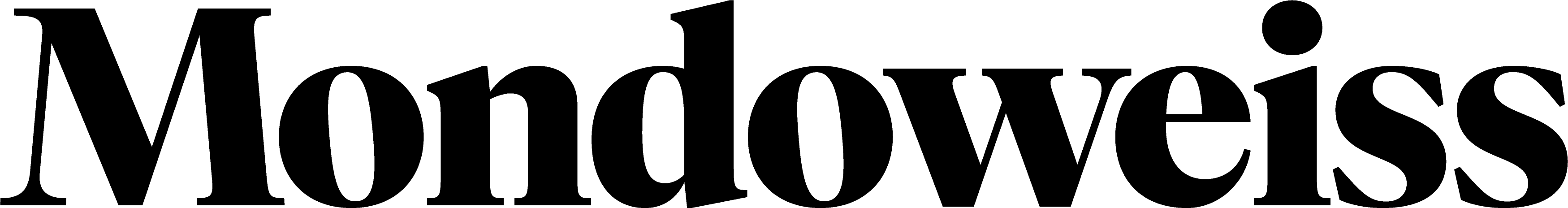Anmerkung der Redaktion: Das ist eine gekürzte Version eines Artikels, der ursprünglich von unserem Syndikatspartner The Nation veröffentlicht wurde. Die vollständige Version auf Englisch kann man hier lesen.
Mindestens vier mit Macheten und Knüppeln bewaffnete Männer brachen in Anne Johnsons Haus ein. Sie zwangen ihren Mann und ihren 11-jährigen Sohn ins Schlafzimmer und hielten Anne und ihre minderjährigen Töchter in einem separaten Raum fest. Bis heute weiß sie nicht sicher, ob es sich bei den Männern, die sie, ihren Mann und ihre Töchter vergewaltigten, um ihre Arbeitskollegen handelte. "Sie sprachen die lokale Sprache", sagte Anne aus, "aber sie verbanden uns die Augen, damit wir nicht sehen konnten, wer sie waren."
Im Jahr 2007, als der Angriff stattfand, lebten und arbeiteten Anne und ihr Mann Makori (ihre Namen sind Pseudonyme, um die Familie vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen) seit mehr als einem Jahrzehnt auf einer kenianischen Teeplantage, die Unilever gehört, dem in London ansässigen Haushaltswaren-Riesen, der für Marken wie Lipton Tee, Dove, Axe, Knorr und Magnum Eiscreme bekannt ist. Im Dezember desselben Jahres schlugen, verstümmelten, vergewaltigten und töteten Hunderte von Männern aus der benachbarten Stadt Kericho die Bewohner*innen der Plantage in einer Woche des Terrors.
Die Angreifer töteten mindestens elf Plantagenbewohner*innen, darunter Makori, den sie vor den Augen seines Sohnes vergewaltigten und tödlich verletzten, sowie eine der Töchter der Johnsons. Sie plünderten und verbrannten Tausende von Häusern und verletzten und vergewaltigten eine unbekannte Anzahl von Menschen, die aufgrund ihrer ethnischen Identität und ihrer mutmaßlichen politischen Zugehörigkeit zur Zielscheibe wurden.
Eine umstrittene Präsidentschaftswahl war Auslöser der Gewalt. Der Kandidat, der von der lokalen Bevölkerung Kerichos favorisiert wurde — und von vielen Unilever-Managern*innen offen unterstützt wurde — verlor gegen den Politiker, von dem man annahm, dass er von Minderheiten unterstützt wurde. Das Massaker beschränkte sich nicht auf die Plantage oder auf Kericho. Mehr als 1.300 Menschen starben in ganz Kenia bei Ausschreitungen nach den Wahlen.
Unilever erklärte, dass die Angriffe auf ihre Plantage unerwartet waren und dass sie deshalb nicht haftbar gemacht werden sollten. Aber Zeug*innen und ehemalige Unilever-Manager sagen, dass die eigenen Mitarbeiter*innen des Unternehmens zu den Angriffen angestiftet und sich daran beteiligt haben. Sie machten diese Anschuldigungen 2016 in einer schriftlichen Zeugenaussage, nachdem der Fall einem Gericht in London vorgelegt wurde. Anne und 217 andere Überlebende wollten, dass Unilever Kenia und seine Konzernmutter in Großbritannien Wiedergutmachung zahlen. Unter den Klägern*innen waren 56 Frauen, die vergewaltigt wurden, und die Familienangehörigen von sieben Menschen, die getötet wurden.
In Hunderten Seiten von Zeugenaussagen und anderen Gerichtsakten sowie in von mir geführten Interviews beschreiben die Überlebenden, wie ihre Kolleg*innen im Vorfeld der Wahl damit drohten, sie anzugreifen, wenn der "falsche" Kandidat gewinnen würde. Als sie diese Kommentare meldeten, wiesen ihre Manager ihre Bedenken zurück, sprachen verschleierte Drohungen aus oder machten selbst abfällige Bemerkungen.
Ehemalige Manager von Unilever Kenia gaben vor Gericht zu, dass das Top-Management des Unternehmens, einschließlich des damaligen Geschäftsführers Richard Fairburn, die Möglichkeit von Gewalt bei den Wahlen in mehreren Meetings diskutierte, aber nur die Sicherheitsvorkehrungen für das leitende Personal, die Fabriken und die Ausrüstung des Unternehmens verschärfte.
Unilever Kenia beharrt darauf, nicht verantwortlich zu sein und beschuldigt die Polizei, zu langsam zu handeln. Derweil behauptet die Konzernmutter in London, dass sie den Arbeiter*innen nichts schuldet und dass die Opfer das Unternehmen in Kenia und nicht in Großbritannien verklagen sollten. Die Arbeiter*innen aber sagen, dass eine Klage in Kenia weitere Gewalt auslösen könnte, auch von ihren bisherigen Angreifern, von denen einige noch auf der Plantage arbeiten.
2018 entschied ein Richter in Großbritannien, dass die Unilever Zentrale in London nicht für die Versäumnisse der kenianischen Tochtergesellschaft haftbar gemacht werden kann. Nun wenden sich Anne und ihre ehemaligen Kolleg*innen an die UN-Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Menschenrechte, die in den nächsten Monaten entscheiden soll, ob Unilever die Richtlinien der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln nicht befolgt hat. Anne erklärte mir: "Das Unternehmen hat versprochen, sich um uns zu kümmern, aber das hat es nicht getan. Deswegen sollten sie uns jetzt bezahlen, damit wir endlich unser Leben wieder aufbauen können."
Die hügelige Teeplantage von Unilever im südlichen Rift Valley in Kenia umfasste im Jahr 2007 etwa 13.000 Hektar. Mit einer Bevölkerung von etwa 100.000 Menschen, darunter etwa 20.000 ansässige Arbeiter*innen samt ihren Familien, und mit Schulen, Kliniken und sozialen Einrichtungen vor Ort sind die Plantagen eine kosmopolitische Unternehmensstadt: Die Arbeiter*innen gehören verschiedenen Ethnien aus dem ganzen Land an.
Die Johnsons stammten aus Kisii, einem Bezirk, der zwei Stunden von den Unilever Gütern entfernt war, und identifizierten sich ethnisch als Kisii. Auf der Plantage machten die Kisiis fast die Hälfte der Bewohner*innen aus, aber im nahe gelegenen Kericho — der Heimat einer ethnischen Gruppe namens Kalenjins — waren sie eine kleine Minderheit. Und viele Menschen in Kericho blickten auf die Kisiis und andere "Fremde" herab. Die Plantage spiegelte diese Kluft wider: Die Kalenjins waren meist im Management tätig, die Kisiis und andere Minderheiten arbeiteten vor allem als Teepflücker*innen.
Das Paar verbrachte den letzten Sonntag im Dezember 2007 wie jeden anderen Tag — auf dem Feld mit einem Korb auf dem Rücken — obwohl sie erwarteten, dass der Abend angespannt sein würde, da die Wahlergebnisse am späten Nachmittag bekannt gegeben werden würden. Anfang der Woche waren Millionen Kenianer*innen zu den Urnen gegangen, um entweder Raila Odinga, der die Orange Democratic Movement (ODM) anführte, oder Mwai Kibaki von der Party of National Unity (PNU) zum neuen Präsidenten zu wählen.
Anne hatte selbst nicht gewählt. Wochen zuvor hatte sie um Urlaub gebeten, um nach Kisii zu reisen, wo sie als Wählerin registriert war, aber ihr Manager lehnte den Antrag ab, sagte sie. Diese Erfahrung war unter den Mitgliedern*innen von Minderheitsvölkern üblich, sagte Daniel Leader, ein Anwalt und Partner bei der Londoner Anwaltskanzlei Leigh Day, der die Überlebenden vor Gericht vertrat und dessen Team alle 218 Kläger*innen interviewte.
Die bevorstehenden Wahlen hatten die Spannungen zwischen den Kalenjin-Arbeitern*innen von Unilever und ihren jüngeren Kisii-Kollegen*innen verschärft. "Sie nahmen an, dass wir Kisiis Mwai unterstützten", erklärte Anne, während die lokale Kalenjin-Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit für Odinga war.
In den Wochen vor der Wahl, so berichten Überlebende, verwandelten ODM-unterstützende Mitarbeiter*innen die Teeplantagen in einen heftig pro-Odinga-Raum und organisierten politische Kundgebungen und Strategietreffen auf dem Grundstück. Anne erzählte mir, dass die Wahrnehmung der Kisiis als Kibaki-Unterstützer*innen dazu führte, dass einige Kalenjins sie mit Feindseligkeit behandelten. Sie sagte, dass die Teamleiter*innen zum Beispiel begannen, ihre Aufgaben Nicht-Kisii-Arbeitern*innen zuzuweisen. Andere Kollegen*innen sprachen überhaupt nicht mehr mit ihr. Zum Leidwesen von Anne fand sie in den Wohngebieten Flugblätter mit hasserfüllten Slogans wie "Foreigners go home"(“Fremde geht nach Hause!”), was sie befürchten ließ, dass "nach der Wahl etwas Schlimmes passieren könnte."
Anne war verängstigt, schwieg aber. "Die Firma ist so groß. Ich nahm an, dass sie uns beschützen würden", sagte sie mir. Diejenigen, die sich weniger sicher fühlten und ihre Manger um Schutz baten, stießen laut den Überlebenden auf Gleichgültigkeit. In Gerichtsaussagen erinnerten sich viele daran, wie verschiedene Manager ihre Bitten um mehr Sicherheit ignorierten oder sie mit den Worten abtaten: "Das ist nur Politik." Andere wiesen die besorgten Arbeiter*innen an, Lobbyarbeit zu betreiben und für Odinga zu stimmen, und sagten, sie würden "gezwungen werden zu verschwinden", wenn sie das nicht täten.
Ein Manager des Unternehmens gab vor dem Londoner Gericht zu, dass das Management von Unilever Kenya — einschließlich des Geschäftsführers Fairburn — gewusst habe, dass "es Unruhen geben würde und dass die Plantage überfallen werden könnte." Sie hätten die Notwendigkeit zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen in mindestens drei Meetings im Dezember besprochen, sagte er. Aber das Management habe nur Maßnahmen ergriffen, um "Firmeneigentum, Fabriken, Maschinen, Lager, Kraftwerke und Managementwohnungen zu sichern", während "kein Gedanke daran verschwendet wurde, die Sicherheit der Wohnlager zu erhöhen, um die Arbeiter*innen zu schützen." Ein anderer ehemaliger Unilever-Manager bestätigte diese Behauptung.
Fairburn, der angeblich dabei anwesend war, weigerte sich, die Treffen zu kommentieren, als ich ihn anrief. Bis heute behauptet Unilever, dass es die Angriffe nicht vorhersehen konnte, obwohl die Medien in Kenia und international, darunter die BBC, Al Jazeera, The New York Times und Reuters, über die bevorstehende ethnische Gewalt berichtet hatten.
"Jeder, der die kenianischen Wahlen im Jahr 2007 verstand, wusste, dass sie in erheblicher und weit verbreiteter Gewalt enden könnten und dass diese Gewalt größtenteils entlang von Identitäts- und Zugehörigkeitslinien ablaufen würde", sagte Tara Van Ho, die an der Universität von Essex Recht und Menschenrechte lehrt. Sowohl Unilever Kenia als auch der Mutterkonzern in London hätten wissen müssen, dass die Arbeiter*innen und ihre Familien in Gefahr waren, so Van Ho weiter. Um sie zu schützen, so argumentierte sie, hätte Unilever zusätzliches Sicherheitspersonal einstellen, seine Wachleute und Manager schulen und ihre Gebäude für die Zeit unmittelbar vor der Wahl absichern oder die Bewohner*innen evakuieren können.
Stattdessen, so Leader, der Anwalt der Arbeiter*innen in London, habe Unilever "eine Situation geschaffen, in der [diese Angestellten] aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit leichte Beute waren."
In der Zwischenzeit sind der Geschäftsführer von Unilever Kenia und andere Führungskräfte nach Angaben der ehemaligen Manager vor der Krise in den Urlaub gefahren, und das Unternehmen evakuierte die verbliebenen Manager und Expats mit Privatjets, sobald die Gewalt ausbrach.
Als die Nachricht von Kibakis Sieg am Sonntagabend kam, bereitete Anne gerade das Abendessen mit ihrer Familie vor. Augenblicke später hörte sie draußen Menschen schreien und wusste, dass sie in Gefahr waren. "Wir haben schnell unsere Türen verschlossen", sagt sie.
In dieser Nacht drangen Hunderte von Männern, bewaffnet mit Macheten, Knüppeln, Kerosinkanistern und anderen Waffen, in die Plantage ein. Sie plünderten und verbrannten Tausende von Kisii-Haushalten — die sie mit einem X markierten — und griffen deren Bewohner*innen an.
Gerichtsakten zeichnen ein erschütterndes Bild von dem, was sich in der nächsten Woche auf der Plantage abspielte. Menschen wurden gruppenvergewaltigt und brutal zusammengeschlagen und sahen, wie ihre Kollegen*innen in Brand gesetzt wurden. Als sie sich in den Teesträuchern in Sicherheit brachten, verfolgten die Angreifer sie mit Hunden.
"Wir wissen die Gesamtzahl der Menschen, die vergewaltigt, getötet und dauerhaft invalide wurden, nicht", sagte mir Leader. Er glaubt, dass die 218 von ihm vertretenen Kläger*innen nicht die einzigen überlebenden Opfer sind. "Viele Menschen haben zu viel Angst vor Vergeltung oder erneuten Angriffen von Kollegen, mit denen sie weiterhin zusammenarbeiten", sagte er.
Die Sorge vor gewalttätigen Repressalien war ein Grund, warum die Überlebenden Unilever in Großbritannien verklagen wollten. Ein anderer war, dass Leigh Day sie kostenlos vertrat, während sich die Überlebenden in Kenia keinen Rechtsbeistand leisten können.
Leigh Day argumentierte, dass ihre kenianischen Mandanten*innen das Recht hatten, Unilever in London zu verklagen, da das britische Recht es Arbeitnehmern*innen von internationalen Tochtergesellschaften erlaubt, die in Großbritannien ansässigen Muttergesellschaften zu verklagen, wenn sie unter anderem nachweisen können, dass die Konzernmutter eine aktive und kontrollierende Rolle im Tagesgeschäft der Tochtergesellschaft spielt. Bei Unilever, so argumentierte Leigh Day, war das eindeutig der Fall.
Die Anwälte von Unilever bestanden dennoch darauf, dass die Opfer ihre Klage in Kenia einreichen sollten und schlugen vor, dass sich die Teepflücker*innen "zusammenschließen" und "finanzielle Mittel von Freunden und Familie sammeln".
Mehrere Opfer sagten, sie hätten ihre Angreifer als Unilever-Kolleg*innen erkannt. Eine Frau sagte dem Gericht, sie sei von fünf ihrer Kollegen angegriffen worden, die sie namentlich identifizierte. Die Männer "fingen an, mich mit einer Metallstange auf meinen Rücken und meine Beine zu schlagen und wollten mich vergewaltigen", sagte sie in ihrer Zeugenaussage, bis "ein Kalenjin-Nachbar, der Krankenpfleger war, eingriff und den Angriff stoppte."
Vor Gericht bestritt Unilever, dass eigene Mitarbeiter*innen an den Angriffen beteiligt waren. Aber als ich Unilever-Vertreter*innen fragte, woher das Unternehmen das wisse, lehnten sie es ab, sich weiter zu diesem Thema zu äußern.
Nachdem die Angreifer gegangen waren, flohen die Johnsons und versteckten sich drei Nächte lang in den Teesträuchern, bevor sie sich mit Schlamm und Blut bedeckt auf den Weg zur Polizeistation im nahe gelegenen Koiwa machten. Von dort aus brachten Polizeibeamte sie in Sicherheit und die Familie konnte nach Kisii fliehen, wo sie ein kleines Stück Land besaß. Ohne Ersparnisse konnten sie die Krankenhauskosten weder für ihre älteste Tochter, die schwere Verletzungen erlitt und von Tag zu Tag schwächer wurde, noch für Makori, der innere Blutungen hatte, aufbringen. In den folgenden Monaten starben beide in ihrem Lehmhaus in Kisii.
Anne sagte, dass die einzige Kommunikation, die sie seit den Angriffen von Unilever erhalten hat, eine Einladung war, Monate später zur Arbeit zurückzukehren, und ein Brief, der ihr etwa 110 Dollar Entschädigung anbot. Der Brief legt nahe, dass dieser Betrag von der Unilever-Zentrale in London festgelegt und bezahlt wurde.
"Im Namen der gesamten Unilever Tea Kenya Ltd Familie.", heißt es dort, "danken wir Unilever für das Verständnis, die materielle und moralische Unterstützung und hoffen, dass diese rechtzeitige Geste dazu beiträgt, dass für unsere Mitarbeiter*innen und ihre Familien wieder Normalität einkehrt."
Anne erzählte mir, dass sie nie wieder auf die Plantage zurückgekehrt ist, weil sie ihren Sohn, der jetzt Mitte 20 ist, nicht verlassen kann. "Er hat nach dem, was passiert ist, sehr schlimme Krampfanfälle und Panikattacken entwickelt und braucht ständige Betreuung", sagte sie. Schwer traumatisiert und nicht in der Lage, sich die notwendige psychologische Behandlung zu leisten, haben ihr Sohn und ihre Tochter aufgehört, zur Schule zu gehen. "Wir leben von Geschenken von Verwandten und Nachbarn und dem wenigen Mais, den wir auf unserem Land anbauen", sagt sie.
Die Kläger*innen sagen, dass Unilever ihnen eine richtige Entschädigung schuldet, aber Unilever besteht darauf, dass es sie bereits kompensiert hat. Die Sprecher*innen des Unternehmens sagten mir, dass es alle Arbeiter*innen, die schließlich auf die Plantage zurückkehrten, mit Bargeld und neuen Möbeln bezahlt und ihren Familien kostenlose Beratung und medizinische Versorgung angeboten hat. Jedoch wollen sie nicht sagen, wie viel das Unternehmen ihnen gegeben hat oder den Brief kommentieren, den Anne mit mir geteilt hat.
Im Sommer 2018 widerlegten Anne und eine Gruppe anderer Opfer diese Behauptungen in einem Brief an Paul Polman, den damaligen CEO des Unternehmens: "Es ist nicht richtig, dass Unilever behauptet hat, uns geholfen zu haben, obwohl wir wissen, dass das nicht stimmt", schrieben sie in dem Brief. Weiter hieß es:
“Unilever wollte nur, dass wir wieder zur Arbeit gehen, als ob nichts passiert wäre [und denjenigen von uns, die es taten], wurde gesagt, dass wir nicht darüber sprechen dürfen, was passiert ist. Wir haben immer noch Angst, dass wir bestraft werden, wenn wir über die Gewalt sprechen.
Unilever behauptet, dass nach der Gewalt jede*r Mitarbeiter*in eine ‘Entschädigung in Form von Sachleistungen’ erhielt, um unseren entgangenen Lohn auszugleichen, und dass wir Ersatzgegenstände oder Bargeld erhielten, um neue Gegenstände als Ersatz für unser gestohlenes Eigentum zu kaufen... aber diejenigen, die zu viel Angst hatten, um zurückzukehren, bekamen nichts, und nur manche von denen, die zurückkehrten, bekamen KES12.000 [$110], etwas mehr als ein Monatsgehalt, und ein wenig Mais, der dann von unserem Gehalt abgezogen wurde. Uns wurde gesagt, dass wir nichts sagen sollten, wenn wir Leute mit unseren Habseligkeiten sahen.”
Polman scheint nicht auf den Brief geantwortet zu haben.
Nach britischem Recht kann eine Muttergesellschaft nur dann für die Gesundheits- und Sicherheitsverstöße ihrer Tochtergesellschaften haftbar gemacht werden, wenn sie ein hohes Maß an Kontrolle über deren Sicherheits- und Krisenmanagementpolitik ausübt.
Um dem Gericht zu beweisen, dass die britische Muttergesellschaft tatsächlich eine solche Kontrolle über Unilever Kenia ausübte, legte Leigh Day Zeugenaussagen von ehemaligen Arbeitern*innen vor, die über die häufigen Besuche von Londoner Managern aussagten, sowie von vier ehemaligen Managern, die bezeugten, dass die Zentrale die Sicherheits- und Krisenmanagementrichtlinien von Unilever Kenia gestaltete, überwachte und prüfte und sogar ihre eigenen Sicherheitsprotokolle zur Pflicht machte. Das bedeutete, dass, wie ein leitender Manager mit über 15 Jahren Erfahrung im Unternehmen es ausdrückte, Unilever Kenia "darauf beschränkt war, sich strikt an die Richtlinien und Verfahren zu halten, die von [Unilever] Plc. nach unten durchgereicht wurden." Ein anderer leitender Angestellter erklärte, dass die "Checklisten und detaillierten Richtlinien von London eingehalten werden mussten, oder ein*e Angestellte*r würde entlassen werden oder mit einer anderen Sanktion rechnen müssen."
Diese Zeugenaussagen schienen die Behauptung von Leigh Day zu stützen, dass die Londoner Zentrale mitverantwortlich war. Doch um es dem Gericht zu beweisen, benötigte die Kanzlei Zugang zum tatsächlichen Text der Protokolle, die die Manager beschrieben. Da es sich jedoch um ein Vorverfahren handelte — was bedeutet, dass das Gericht die Zuständigkeit nicht anerkannt hatte —, war Unilever nicht verpflichtet, relevante Materialien offenzulegen und verweigerte einfach die Herausgabe der Dokumente.
Die Entscheidung des Richters machte deutlich, dass die "Schwäche" ihrer Beweise eine wichtige Rolle bei ihrer Entscheidung spielte, den Kenianern*innen die Klage zu verweigern. Menschenrechtsforscher*innen und Verfechter*innen der Unternehmensverantwortung verurteilten die Entscheidung. Das Gericht habe eine Zwickmühle für die Arbeiter*innen geschaffen, bemerkte Van Ho: "Die Kläger*innen konnten die Dokumente nicht bekommen, die zeigten, dass Unilever UK etwas falsch gemacht hat, bis sie die Dokumente hatten, die zeigten, dass Unilever UK etwas falsch gemacht hat." Es ist "schwindelerregend", sagte sie, und "eine unfaire Erwartung an Arbeitnehmer*innen, die viel weniger Macht haben als das Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, das sie beschäftigt."
Anne sagte, dass sie weiterhin hofft, dass internationale Menschenrechtsanwält*innen ihre Sache unterstützen werden. Zusammen mit anderen Opfern reichte sie kürzlich bei den Vereinten Nationen eine Beschwerde gegen Unilever ein, weil das Unternehmen gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen habe. Eine Anforderung ist, dass Unternehmen sicherstellen müssen, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen in ihrer Lieferkette Zugang zu Wiedergutmachung haben. Van Ho geht davon aus, dass das UN-Gremium, das in Kürze eine Entscheidung treffen soll, zustimmen wird, dass Unilever gegen diese Richtlinien verstoßen hat. "Sich hinter rechtlichen Schlupflöchern zu verstecken und sich zu weigern, relevante Informationen offenzulegen, um die Zahlung von Reparationen zu vermeiden, ist das genaue Gegenteil von dem, was die Guiding Principles vorschreiben", sagte sie.
Obwohl die Vereinten Nationen Unilever nicht zwingen können, zu zahlen, hofft Anne, dass der Fall die Aufmerksamkeit und den öffentlichen Druck erzeugt, die notwendig sind, um das Unternehmen in diese Richtung zu drängen. Auf die Frage, was es für sie bedeuten würde, wenn die Arbeiter*innen Erfolg hätten, sagte sie mir: "Es wäre der größte Moment in meinem Leben."
Maria Hengeveld ist eine investigative Journalistin, die sich auf Arbeitsrechte und die Rechenschaftspflicht von Unternehmen konzentriert. Sie ist zudem Doktorandin und Gates-Stipendiatin am King's College in Cambridge.
Foto: Bryon Lippincott / Flickr