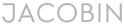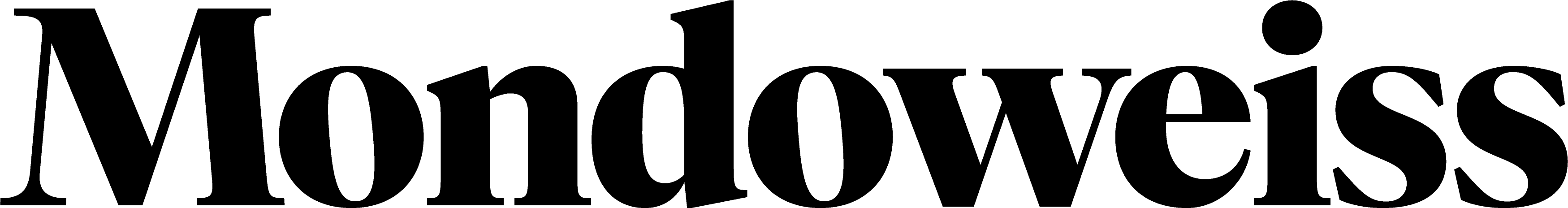Das Jahr 2024 ist vorbei, und mit seinem Ausklang erreichte die Zahl der Menschen, die an den Grenzen Spaniens starben, einen historischen Höchststand. Nach Angaben der NGO Caminando Fronteras starben oder verschwanden in den letzten zwölf Monaten mindestens 10.457 Menschen beim Versuch, Spanien auf illegalen Seewegen zu erreichen – ein Anstieg von 58 Prozent gegenüber 2023. Die überwiegende Mehrheit dieser Opfer (9.757) versuchte, die spanischen Kanarischen Inseln vor der westafrikanischen Küste zu erreichen; das harte Durchgreifen der Europäische Union (EU) im zentralen Mittelmeerraum und der Krieg in Mali zwangen Zehntausende dazu, auf tückischen Langstreckenrouten auf dem Atlantischen Ozean ihr Leben zu riskieren.
Die Migrant*innen machen die Überfahrt größtenteils in traditionellen hölzernen Fischerbooten, sogenannten Cayucos, und können auf dieser Route zwischen vier Tagen und zwei Wochen auf dem Meer verbringen – wobei viele dieser Reisen durch häufige Motorausfälle auf diesen Booten noch erschwert werden. „Das Boot begann zu treiben; wir wurden von den Wellen mitgerissen“, schilderte T. D., ein malischer Überlebender einer solchen Tragödie. Als an Bord seines Cayuco das Essen und das Wasser ausgingen, so erzählte T. D. Caminando Fronteras, „ wurde ein Leben nach dem anderen ausgelöscht. Ich dachte, ich wäre der Nächste, aber es war mein Bruder“, fährt er fort. „Ich sagte ihm, er solle kein Meerwasser trinken und durchhalten, aber er trank weiter und musste sich erbrechen. Dann setzte er sich hin und hörte auf zu sprechen. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, seinen Körper über Bord zu werfen; andere Leute haben es tun müssen.“
Vor ihrer Rettung mussten T. D. und die anderen Überlebenden den Tod einer ganzen Familie miterleben: „Der Vater warf sich schließlich ins Meer, nachdem er das letzte seiner Kinder dem Wasser übergeben hatte. Wir hatten keine Kraft mehr, ihn aufzuhalten.“
Zu den Tausenden anderen, die ebenfalls ihr Leben ließen, gehörten auch die etwa zweihundert Menschen, die Mitte August mit einem Cayuco von Mbour im Senegal aus in See stachen. Über einen Monat später stießen senegalesische Fischer auf das Boot, das mehr als 80 km vor der Küste von Dakar trieb. An Bord befanden sich dreißig Leichen in fortgeschrittenem Verwesungszustand und der Rest der Passagiere wurde vermisst, sie waren vermutlich tot. Die jüngsten Opfer waren die sechs nicht identifizierten Menschen, die am 13. Dezember 2024 auf El Hierro, der kleinsten der Kanarischen Inseln, begraben wurden, nachdem sie auf ihrer fast 650 km langen Überfahrt von Mauretanien aus an Unterkühlung gestorben waren.
„Während die Zahl der Todesopfer weiterhin dramatisch ansteigt, verfolgt der spanische Staat mit Unterstützung Europas weiterhin eine Politik, die sich auf die Kontrolle der Migration konzentriert und deren Auswirkungen das Recht auf Leben leugnet“, betont Caminando Fronteras im Jahresendbericht. „Diese [Grenz-]Politik basiert auf der Entmenschlichung und Kriminalisierung von Migrant*innen, wodurch sie anfällig für Menschenrechtsverletzungen werden und ihr Leben in fremde Hände geben.“
Somit darf das Phänomen des Massensterbens an den Grenzen Spaniens nicht einfach als eine Reihe isolierter Tragödien verstanden werden. Alle, die ihr Leben verloren haben, sind Opfer des brutalen Grenzregimes der Festung Europa, das sie unter dem Vorwand, Migrant*innen und Flüchtlinge aus dem globalen Süden von der Einreise abzuhalten, dazu zwingt, sich immer größeren tödlichen Gefahren auszusetzen. Doch der historische Anstieg der Migration auf die Kanarischen Inseln in den letzten achtzehn Monaten zeigt auch die begrenzte Wirksamkeit solcher Eindämmungsmaßnahmen, die so vielen Leid zufügen und andere wiederum zum Tod verurteilen. Diese Politik behauptet in betrügerischer Absicht, die tieferen Gründe anzugehen, warum Menschen eine solche Reise überhaupt riskieren.
Unterdrückung outsourcen
Dies war ein Punkt, den Juan Carlos Lorenzo, der kanarische Koordinator der spanischen Kommission für Flüchtlingshilfe, unbedingt ansprechen wollte, als ich im Oktober mit ihm sprach. „Menschenmigration, insbesondere wenn es sich um Zwangsvertreibung handelt, ist nicht aufzuhalten“, betonte er. „Die EU-Politik, die Grenzsicherung an Drittstaaten [Nicht-EU-Staaten] wie Marokko oder Tunesien auszulagern, könnte zwar die Migrantenströme entlang bestimmter Routen durch den Einsatz repressiver Maßnahmen vorübergehend eindämmen, aber solche vorübergehende Reduzierungen können nur erreicht werden, indem die Menschen zu anderen Orten entlang der Südgrenze der EU gedrängt und auf noch riskantere Routen gezwungen werden, beispielsweise von Mauretanien und Senegal auf die Kanaren.“
Tatsächlich kamen in den letzten zwölf Monaten mehr als 46.000 Migrantinnen auf den Kanarischen Inseln an, 20 Prozent mehr als die Gesamtzahl von 2023 – die bislang höchste Zahl in den letzten dreißig Jahren. In einem aktuellen Interview mit El País erklärte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge in der Sahelzone, Xavier Creach, diesen Anstieg mit zwei Faktoren. Zum Ersten hat der sich verschärfende bewaffnete Konflikt in Mali dazu geführt, dass mindestens 200.000 Flüchtlinge in das benachbarte Mauretanien vertrieben wurden. Vor diesem Hintergrund stellten die Malier\innen im Jahr 2024 erstmals die größte nationale Gruppe derjenigen dar, die die Kanarischen Inseln erreichten, vor Senegales*innen und Marokkaner*innen.
Creach verbindet jedoch diesen demografischen Wandel unter den in Spanien ankommenden Menschen mit einem zweiten Punkt: Strengere Grenzkontrollen entlang des zentralen Mittelmeers machen es für Flüchtende und Migrantinnen immer schwieriger, nach Italien zu gelangen, wo die illegale Migration in diesem Jahr um 60 Prozent zurückgegangen ist. Dies war zuvor ein wichtiges europäisches Ziel für Flüchtende aus Mali gewesen. Doch im Zuge des strategischen über eine Milliarde Euro schweren Partnerschaftsabkommens Tunesiens mit der EU im vergangenen Sommer begann der nordafrikanische Staat brutal gegen Migrantinnen vorzugehen, was die Route nach Norden in Richtung Mittelmeer erschwerte und die Migrationsströme aus der Sahelzone auf die Kanaren umleitete.
Als Reaktion darauf sagten Spanien und die EU einem Gesamtpaket von 500 Millionen Euro zu, um Mauretaniens darin zu stärken, die Weitermigration einzudämmen – zumal die Sicherheitskräfte Mauretaniens viele der gleichen missbräuchlichen Praktiken gegen Migrantinnen anwandten, die auch aus anderen Staaten, die mittlerweile „partnerschaftlich“ mit der EU arbeiten, bekannt sind, wie etwa willkürliche Inhaftierungen, körperliche Gewalt und Zwangsumsiedlungen ins Landesinnere. Im November tauchten schockierende Aufnahmen von Hunderten von Migrant\innen auf, die in einem dicht gedrängten Lagerhaus in Mauretanien eingesperrt waren, Bilder, die an Haftanstalten in Libyen erinnern. Dennoch ist es dem dünn besiedelten Staat mit einer 800 Kilometer langen Küste noch nicht gelungen, eine nachhaltige, umfassende Eindämmungsstrategie einzuführen, da immer mehr Migrant*innen aus so weit entfernten Ländern wie Pakistan, Bangladesch und Ägypten u.a. in Mauretanien als alternativem Zugangspunkt zum Mittelmeer ankommen.
Spanische Verantwortung
Aber es ist klar, dass die Politik der linksgerichteten Koalitionsregierung Spaniens direkte Auswirkungen auf die steigende Zahl der Todesopfer im Atlantik hat – auch wenn viele liberale Kommentator*innen im englischsprachigen Raum die Rhetorik von Premierminister Pedro Sánchez über die Vorteile der Einwanderung loben. Diskursiv hat sich Sánchez in den letzten Monaten unter den EU-Spitzenpolitiker*innen deutlich hervorgetan, insbesondere durch seine scharfe Ablehnung des Plans der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni, Asylsuchende in Internierungszentren nach Albanien zu schicken. Dies wiederum hat dazu geführt, dass die konservative Partido Popular ihm vorwirft, dass er einen „Pull-Effekt“ erzeugt und Spanien als attraktives Ziel für die illegale Einwanderung erscheinen lässt. Ihr Vorsitzender Alberto Núñez Feijóo hat vermehrt zu der Art von einwanderungsfeindlichen Einschüchterungstaktiken gegriffen, die zuvor die Domäne der rechtsextremen Vox waren.
Darüber hinaus dürfte die Regierung von Sánchez auch den Status von 900.000 illegalen Migrant*innen in den nächsten drei Jahren legalisieren, nachdem das spanische Parlament im November einen Gesetzentwurf zu diesem Thema verabschiedet hat. Doch die Mehrheit der Migrant*innen, die davon profitieren sollen, stammen aus Lateinamerika und kamen mit dem Flugzeug nach Spanien, ohne ihr Leben auf dem Meer zu riskieren.
Im Gegensatz dazu hat die Sánchez-Regierung in Bezug auf die Einwanderung entlang der südlichen Grenzen Spaniens eine Politik vorangetrieben, die das Leben der Flüchtenden noch weiter gefährdet. Erstens hat es in Zusammenarbeit mit der EU-Grenzagentur Frontex und der senegalesischen Marine die Luft- und Seeüberwachungsmaßnahmen an der senegalesischen Küste intensiviert. Da spanische Drohnen das Gebiet nun überwachen und immer mehr Boote abgefangen und in den Senegal zurückgebracht werden, sind Cayucos gezwungen, immer weiter aufs Meer hinauszufahren, um nicht entdeckt zu werden – und gehen damit noch größere Risiken ein.
„Wenn ich die Nachricht höre, dass ein Boot in der Nähe der Insel gesichtet wurde, achte ich als Erstes auf seine genaue Route, für den Fall, dass es El Hierro völlig verfehlen könnte“, erklärt Juan Miguel Padrón, der Bürgermeister der Hafenstadt El Pinar, wo in diesem Jahr Tausende Menschen angekommen sind. Da Cayucos nicht mehr in der Nähe der afrikanischen Küste fahren können, ist El Hierro als westlichste der Kanarischen Inseln in den letzten anderthalb Jahren zum Hauptankunftsort für Boote aus dem Senegal geworden. Aufgrund der stärkeren Meeresströmungen auf dieser Route besteht jedoch die Gefahr, dass Boote einfach in den Atlantik abgetrieben werden. „Es gab Fälle, in denen Boote mit fünfzehn bis achtzehn Toten an Bord bis nach Costa Rica und an die Küste Lateinamerikas gespült wurden“, erzählt mir Padrón. „Jenseits von El Hierro gibt es nur noch das Meer.“
Der Caminando Fronteras-Bericht weist auch auf einen weiteren kritischen Aspekt des ausgelagerten Grenzsicherungssystems Spaniens hin und stellt fest, dass bei mindestens 150 Todesopfern eine „direkte Untätigkeit bei Such- und Rettungsaktionen ausschlaggebend“ war. Die NGO, die eine Notrufnummer für Migrant*innen betreibt, nennt als Beispiel einen Cayuco mit 150 Menschen, der im Oktober vom Norden Senegals aus in See stach. Caminando Fronteras erhielt fünf Tage nach ihrer Abreise einen Notruf von ihrem Holzboot – die spanische Küstenwache lokalisierte es in einem Gebiet am Rande der Such- und Rettungszonen Spaniens, Marokkos und Mauretaniens. Nach Angaben der NGO schoben die drei Länder dann mehrere Tage lang die Verantwortung für die Rettung von einem Land auf das andere, bis das Boot nach zehn Tagen auf See schließlich in Mauretanien an Land trieb. Bis dahin waren 28 Menschen gestorben.
Caminando Fronteras bezeichnet diese Todesfälle als „eine völlig vermeidbare Tragödie“ und sieht diesen Fall als beispielhaft dafür, wie der spanische Staat Such- und Rettungsdienste sogar in „ein weiteres Instrument zur Migrationskontrolle umgewandelt hat, was direkt zu einem Anstieg der Zahl der Todesfälle auf Migrationsrouten führt“. „Die Hauptsache ist, sie daran zu hindern, Spanien zu erreichen, alles andere ist unwichtig“, sagt ein guineischer Politiker gegenüber der NGO. „Spanien fordert [die marokkanische Küstenwache] auf, sich darum zu kümmern, Marokko kann etwas tun oder auch nicht, wichtig ist nur, dass es angekündigt wurde und Spanien daher nicht länger dafür verantwortlich ist… Es spielt keine Rolle, wenn unsere jungen Leute nicht überleben.“
Kollektives Verschwinden
Von denen, die beim Versuch, die Kanarischen Inseln zu erreichen, sterben, verschwindet die überwiegende Mehrheit einfach im Atlantik. Nur schätzungsweise 4 Prozent der sterblichen Überreste werden jemals geborgen. Von dem geringen Prozentsatz der von den spanischen Behörden geborgenen Leichen werden weniger als die Hälfte tatsächlich identifiziert. Ein vernichtender Bericht der Internationalen Organisation für Migration über Spanien aus dem Jahr 2022 zeigt auf, dass es „für Angehörige vermisster oder verstorbener Migrantinnen praktisch unmöglich ist, Such-, Identifizierungs- oder Rückführungsprozesse einzuleiten oder sich daran zu beteiligen“. Dies hat wiederum zu dem Phänomen geführt, dass auf den Küstenfriedhöfen Spaniens Hunderte [namenloser Migrantinnengräber](https://unbiasthenews.org/counting-the-invisible-victims-of-spains-eu-borders/) zu finden sind, da die Familien über das Schicksal ihrer Angehörigen im Dunkeln gelassen werden. Viele liegen nur wenige Meter von den Massengräbern des spanischen Bürgerkriegs entfernt.
„Wir sprechen von einem kollektiven Verschwinden“, betont Helena Maleno, Direktorin von Caminando Fronteras, in einem Interview aus dem Jahr 2023. „Spanische und europäische Behörden lassen selektiv bestimmte Bevölkerungsgruppen sterben, indem sie die Boote absichtlich auf hoher See treiben lassen, oder töten sie in bestimmten Fällen sogar direkt durch Massaker, wie wir in Tarajal und Melilla gesehen haben.“
Wie zahlreiche Experten und NGOs argumentieren, muss jede Alternative zu dieser bösartigen Nekropolitik darin bestehen, den Menschen aus dem globalen Süden, insbesondere Asylsuchenden, sichere, geordnete und reguläre Migrationsmöglichkeiten anzubieten. Doch die politische Richtung innerhalb der EU schließt dies eindeutig aus, da der neue Migrationspakt des Blocks für 2026 wahrscheinlich die repressivsten und strafendsten Aspekte des Grenzregimes verstärken wird. Insbesondere zielt es darauf ab, die Abschiebung illegaler Migrant*innen zu erhöhen und den Ausweisungsprozess zu beschleunigen. Gleichzeitig schafft es mit seinem neuen „Screening“-Mechanismus neue rechtliche Unklarheiten in Bezug auf das Recht der durch europäische Such- und Rettungsaktionen auf See geretteten Personen, EU-Territorium zu betreten.
Gleichzeitig setzt sich Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska, ein Mitglied von Sánchez‘ Mitte-Links-Partei Partido Socialista (PSOE), dafür ein, dass Frontex‘ Mandat in Westafrika verlängert wird, um der Agentur die direkte Stationierung und Durchführung von Patrouillen vor der Küste Mauretaniens, Senegals und Gambias zu ermöglichen. Sollte sich im Jahr 2025 erneut bestätigen, dass die Atlantikroute zu den Kanaren die tödlichste Migrations-Seeroute der Welt ist, könnten sich die Bedingungen noch verschlechtern, während die Militarisierung der Grenze weiter voranschreitet.