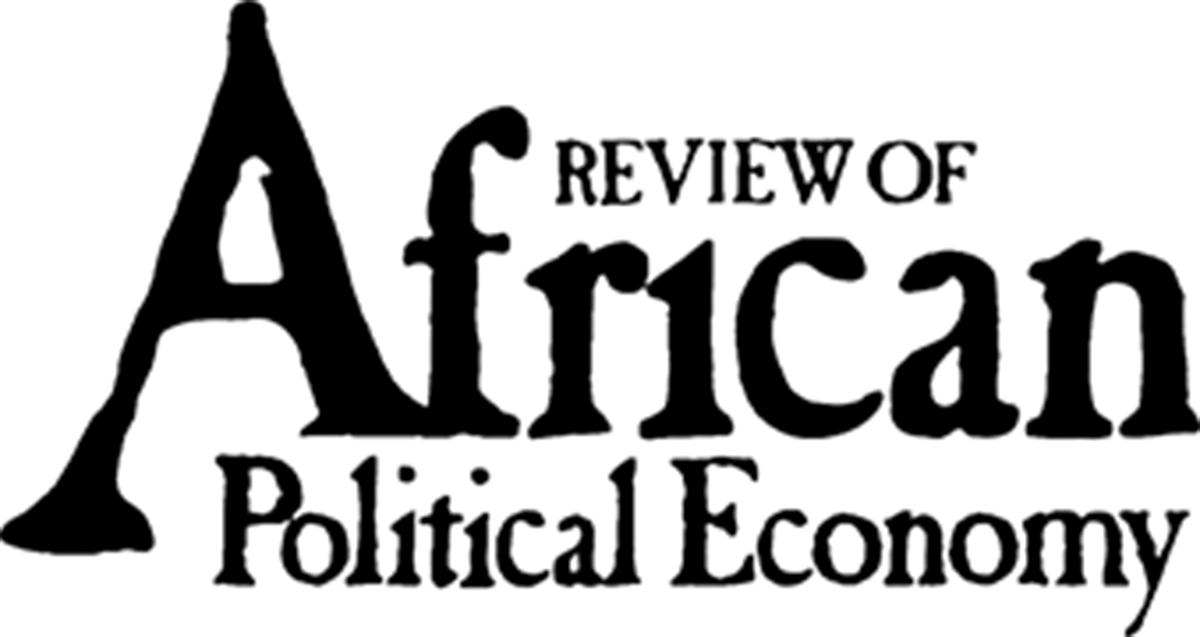Am 15. Mai 2025 hielt der Wirtschaftsanthropologe, Degrowth-Theoretiker und Autor populärer Werke wie Less is More Jason Hickel im Rahmen der dritten jährlichen GRIP-Vorlesung an der Universität Bergen, die vom Brüsseler Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung gesponsert wurde, eine provokative lectio magistralis. In seinem Vortrag mit dem Titel „Der Kampf für Entwicklung im 21. Jahrhundert“ demontierte Hickel die Vorstellung, dass die Entwicklung des globalen Südens innerhalb der Logik des extraktiven Kapitalismus und des Wirtschaftsimperialismus stattfinden könne. Stattdessen, so argumentierte er, sei es nur durch Bewegungen für wirtschaftliche Souveränität und eine ökosozialistische Umstellung möglich, den Fallen der neokolonialen Ausbeutung zu entkommen.
Im Anschluss an die Konferenz sprach er mit Don Kalb, Maria Dyveke Styve und Federico Tomasone über konkrete politische Strategien im Kampf für Klima- und Umverteilungsgerechtigkeit und sann über die Widersprüche des Liberalismus, die ökologischen und sozialen Krisen des globalen Kapitalismus und die Möglichkeiten für eine demokratische sozialistische Zukunft nach. In der Diskussion sprach Hickel über seine sich ständig weiterentwickelnde Perspektive auf die marxistische Theorie, kritisierte die Grenzen horizontaler Politik und unterstrich die Dringlichkeit, neue politische Instrumente zu schaffen, die in der Lage sind, auf die planetarische Notlage zu reagieren.
DK: Gestern haben Sie argumentiert, dass es unerlässlich ist, die Russische Revolution und die Geschichte Chinas neu zu überdenken – nicht nur für die internationale Politik, sondern auch für die Politik der Arbeiterklasse und der globalen Freiheit. Es fiel mir auf, dass Ihr Narrativ nun eher zu einer expliziteren antiliberalen Lesart der jüngsten Geschichte neigt. Das war in The Divide nicht so klar, aber in Ihrem Vortrag wurde es deutlich. Haben Sie sich zu einer marxistischeren Interpretation entschlossen?
Ja, ich denke, das ist so. Das liegt wohl an zwei Dingen. Erstens ist meine Analyse im Laufe der Zeit schärfer geworden. Zweitens, als ich The Divide schrieb, wandte ich mich an ein Publikum, das mit marxistischer oder sozialistischer Sprache weitgehend unvertraut war und sich dabei oft unbehaglich fühlte. Ich wollte effektiv mit Menschen kommunizieren, die in der internationalen Entwicklung arbeiten und von denen viele misstrauisch gegenüber dem sind, was sie für ideologische Etiketten halten.
Diese strategische Entscheidung hatte ihren Preis: The Divide umgeht die Frage des Sozialismus weitgehend, obwohl viele der Länder, die ich darin behandle, sozialistisch waren oder kommunistische Revolutionen durchgemacht haben. Diese Lücke schwächt die Analyse. Man kann die Geschichte der globalen Ungleichheit nich vollumfänglich begreifen, ohne sich mit den Versuchen der sozialistischen Revolutionen und der Bewegung der Blockfreien Staaten auseinanderzusetzen, die darauf abzielten, mit dem kapitalistischen Imperialismus zu brechen und alternative Entwicklungsmodelle einzuführen, gefolgt von der gewaltsamen Gegenreaktion des Westens in Form des Kalten Krieges.
Seitdem habe ich vermehrt Konzepte wie das kapitalistische Wertgesetz verwendet, das ich mittlerweile als wesentlich für die Erklärung unserer ökologischen und sozialen Krisen ansehe. Wir leben in einer Welt mit immensem Produktionspotenzial, und dennoch stehen wir vor Deprivation und ökologischem Zusammenbruch. Warum? Weil im Kapitalismus die Produktion nur stattfindet, wenn und wo sie profitabel ist. Soziale und ökologische Bedürfnisse sind gegenüber den Renditen des Kapitals zweitrangig.
DK: Genau das ist mir aufgefallen. Ich habe Ihre Arbeit mit der von David Graeber verglichen. Sie beide beginnen in der Anthropologie und expandieren in die Politik, aber der entscheidende Unterschied ist, glaube ich, dass Sie das Wertgesetz begreifen – während Graeber als Anarchist dazu neigt, ihm auszuweichen. Sind Sie auch der Meinung, dass die heutigen Bedingungen uns dazu zwingen, zentrale marxistische Konzepte zurückzubringen und sie einem jüngeren Publikum zu vermitteln?
Absolut. Als Wissenschaftler sollten wir die besten verfügbaren Werkzeuge nutzen, um die materielle Realität zu erklären – und marxistische Konzepte bleiben analytisch schlagkräftig. Wir befinden uns in einem Moment, in dem diese Werkzeuge wieder eingeführt und auf eine neue Art und Weise populär gemacht werden können.
David Graeber war ein brillanter und äußerst kreativer Denker, und ich habe viel von ihm gelernt – sowohl als Freund als auch als Gelehrter. Aber Sie haben Recht, er ging anders an die politische Ökonomie heran. In seinen späteren Arbeiten, insbesondere The Dawn of Everything, begann er, die Grenzen anarchistischer Organisationsmodelle wie des Horizontalismus anzuerkennen. Er sah die Notwendigkeit von funktionalen Hierarchien – Strukturen, die Angelegenheiten tatsächlich erledigen können, ohne die egalitären Prinzipien zu verraten.
DK: Das bringt mich zu einer anderen Frage. Im Jahr 2011 hat die populistische Linke es versäumt, das vorherzusehen, was ich eine globale Konterrevolution nennen würde. Was wir heute sehen, ist nicht nur ein Wiederaufleben des Faschismus – es ist ein breiterer antiliberaler und antineoliberaler Aufstand. Einige Kräfte sind anti-woke, andere anti-globalistisch, und sie teilen nicht immer eine einheitliche Ideologie, aber ein Teil des Sogs ist anti-liberal und potenziell auch anti-kapitalistisch. Wie geht Ihre Arbeit mit dieser komplexen Reaktion um?
Es ist paradox. In gewisser Weise scheint dies der schlechteste Moment zu sein, um über Sozialismus zu sprechen. Aber andererseits ist es genau der richtige Moment – denn der Liberalismus bricht sichtlich zusammen, und der Aufstieg des Rechtspopulismus ist ein Symptom für dieses Scheitern.
Der Liberalismus behauptet, sich für universelle Rechte, Gleichheit und Umweltschutz einzusetzen, aber er hält auch an einem Produktionsmodell fest, das von Kapital und Profitmaximierung dominiert wird. Jedes Mal, wenn diese beiden Verbindlichkeiten aufeinanderprallen, entscheiden sich liberale Führer für das Kapital – und jeder sieht die Verlogenheit. Das ist der Grund, warum der Liberalismus an Legitimität verliert. Die Gefahr besteht darin, dass unzufriedene Arbeiter*innen in Ermangelung einer überzeugenden linken Alternative zu rechten Narrativen tendieren – fremdenfeindliche Verschwörungstheorien, Einwanderer als Sündenböcke darstellen und so weiter. Faschist*innen bieten keine wirklichen Lösungen an, aber sie füllen eine Lücke, die liberale und sogar sozialdemokratische Parteien hinterlassen haben, welche jegliche strukturelle Kritik am Kapitalismus aufgegeben haben.
Wir brauchen eine demokratisch-sozialistische Alternative, die sich mit den grundlegenden Widersprüchen des Kapitalismus befasst, einschließlich seiner ökologischen Irrationalität. Aber um diese Alternative aufzubauen, braucht es echte politische Instrumente – nicht nur Protestbewegungen, sondern Massenparteien mit tiefen Wurzeln in der Arbeiterklasse.
DK: Kehren wir zur Idee des Wertgesetzes zurück. Sie haben es vorhin angesprochen, aber können Sie erklären, warum es so wichtig ist, die Krisen zu verstehen, mit denen wir heute konfrontiert sind?
Das Wertgesetz erklärt, warum wir selbst in einem Zeitalter beispielloser Produktionskapazitäten einen Mangel an sozial und ökologisch lebenswichtigen Gütern erleben. Im Kapitalismus wird die Produktion nicht von menschlichen oder ökologischen Bedürfnissen geleitet, sondern von der Rentabilität. Wenn etwas nicht rentabel ist, wird es nicht hergestellt – egal wie notwendig es ist.
Nehmen Sie den ökologischen Wandel. Wir haben das Wissen, die Arbeitskräfte und die Ressourcen, um schnell eine Infrastruktur für erneuerbare Energien aufzubauen, Gebäude nachzurüsten und den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Aber das sind keine rentablen Investitionen, also finanziert das Kapital sie nicht. In der Zwischenzeit produzieren wir weiterhin Luxusgüter, fossile Brennstoffe und Waffen – Dinge, die den Menschen und dem Planeten aktiv schaden –, weil sie profitabel sind. Dieser Widerspruch ist der Kern unseres ökologischen Zusammenbruchs.
Das Lustige dabei ist, dass wenn Menschen über Knappheit sprechen, sie sich oft auf die sozialistische Welt beziehen und dabei die Sanktionen und Blockaden gegen diese Volkswirtschaften ignorieren, obwohl ihre sozialen Ergebnisse besser waren als die kapitalistischen. Heute produziert der Kapitalismus selbst chronische Engpässe – bei bezahlbarem Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Bildung und grünen Technologien. Dies ist eine direkte Folge des Wertgesetzes. Wir müssen es beseitigen, wenn wir überleben wollen.
FT: Damit komme ich nach Europa. Die Europäische Union hat in den letzten Jahren versucht, eine grün-kapitalistische Agenda voranzutreiben, aber jetzt sehen wir eine große Verschiebung in Richtung Militarisierung. Auffällig ist, dass diese Agenda von selbsternannten Liberalen vorangetrieben wird. Starmer in Großbritannien, zum Beispiel, steht an der Spitze. Das Gleiche gilt im Europäischen Parlament. Wie interpretieren Sie diese Entwicklung?
Sie ist zutiefst beunruhigend. Jahrelang haben uns die europäischen Staats- und Regierungschefs gesagt, dass es kein Geld gibt, um in die Dekarbonisierung, öffentliche Dienstleistungen oder sozialen Schutz zu investieren – weil wir das Defizit und die Schuldenquoten aufrechterhalten müssen, um die Preise stabil zu halten. Aber plötzlich, wenn es um die Militarisierung geht, werden diese Regeln über Bord geworfen. Sie sind bereit, Billionen für Waffen und Verteidigung auszugeben.
Dies offenbart etwas Entscheidendes: Bei den Defizitregeln ging es nie um die Ökonomie. Sie waren politische Instrumente, um Investitionen in soziale und ökologische Ziele zu blockieren und gleichzeitig eine künstliche Verknappung öffentlicher Güter aufrechtzuerhalten. Jetzt, da die Militärausgaben politisch opportun und profitabel sind, verschwinden die Einschränkungen. Es ist ein Verrat an der Arbeiterklasse und den zukünftigen Generationen.
Darüber hinaus ist ihre Analyse fehlerhaft. Sie scheinen zu glauben, dass die Militarisierung Europa Souveränität und Sicherheit bringen wird, aber wahre Souveränität würde ein völliges Umdenken in der geopolitischen Rolle Europas erfordern. Es würde bedeuten, sich von den Vereinigten Staaten zu distanzieren und die Integration und eine friedliche Zusammenarbeit mit dem Rest des eurasischen Kontinents – einschließlich China – und dem globalen Süden voranzutreiben. Stattdessen bleiben die europäischen Eliten in der Logik der US-Hegemonie gefangen. Westeuropa wird seit Jahrzehnten als vorgeschobener Stützpunkt für die US-Militärstrategie angesehen. Deutschland, zum Beispiel, ist voll von amerikanischen Stützpunkten. Die USA wollen, dass Europa den Osten verschmäht – aber das ist im Interesse der USA, nicht im Interesse Europas. Wir müssen dies ablehnen. Europas wahre Interessen liegen im Frieden und in der Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn.
FT: Das ist eine perfekte Überleitung zu meiner zweiten Frage: die historische Last des europäischen Imperialismus. Die herrschenden Klassen Europas haben in den letzten Jahrhunderten enormen Schaden angerichtet. Wie können wir über dieses Erbe hinwegkommen? Gibt es wirklich einen Widerspruch zwischen den Interessen der europäischen Arbeiterklasse und denen des Kapitals, wenn es um die Außenpolitik geht?
Das ist eine wichtige Frage. Zunächst einmal: Ja, eine Politik wie die aktuelle Militarisierungswelle ist eindeutig auf die Interessen des europäischen Kapitals ausgerichtet. Deshalb passiert sie. Aber sie läuft den Bedürfnissen der einfachen Menschen und der Stabilität des Planeten direkt zuwider. Dies offenbart eine tiefere Wahrheit: Es gibt einen fundamentalen Konflikt zwischen den Interessen der arbeitenden Bevölkerung und denen des Kapitals. Er zwingt uns, uns mit dem Mythos der europäischen Demokratie auseinanderzusetzen. Uns wird gesagt, Europa sei ein Leuchtfeuer demokratischer Werte, aber in Wirklichkeit werden unsere Institutionen von den Interessen des Kapitals beherrscht.
Die Demokratie war nie ein Geschenk der herrschenden Klasse – sie wurde von den Arbeitenden erkämpft. Dabei bekamen wir auch nur eine oberflächliche Version davon. Die ursprünglichen demokratischen Forderungen – Dekommodifizierung lebenswichtiger Güter, Demokratie am Arbeitsplatz, Kontrolle über die Finanzen – wurden aufgegeben. Stattdessen haben wir alle paar Jahre Wahlen zwischen Parteien, die alle dem Kapital dienen, in einem von Milliardären dominierten Medienumfeld. Wenn wir echte Demokratie wollen, müssen wir sie auf die Wirtschaft ausweiten. Das bedeutet, das kapitalistische Wertgesetz zu beseitigen und die Produktion auf soziale und ökologische Bedürfnisse auszurichten. Das bedeutet, die Geldschöpfung zu demokratisieren.
DK: Nehmen wir diesen Faden auf – Geld. Einer der originelleren Aspekte Ihrer Arbeit ist die Fokussierung auf die Produktion von Geld selbst. Könnten Sie erklären, wie sich die monetäre Souveränität in Ihre umfassendere Kritik am Kapitalismus einfügt?
Im Kapitalismus hält der Staat das gesetzliche Monopol über die Emission der Landeswährung, aber in der Praxis überlässt er diese Befugnis den Geschäftsbanken. Banken erarbeiten den größten Teil des Geldes in der Wirtschaft durch die Vergabe von Krediten. Aber sie vergeben nur dann Kredite, wenn sie erwarten, dass sie rückzahlbar und damit rentabel sind – wenn sie der Akkumulation von Kapital dienen. Das bedeutet, dass die Macht, Geld zu schaffen und damit Arbeit und Ressourcen zu mobilisieren, der kapitalistischen Profitabilität untergeordnet ist. Das ist ein direkter Ausdruck des kapitalistischen Wertgesetzes. Produktionskapazitäten werden nur dann aktiviert, wenn sie Renditen für das Kapital abwerfen. So steuern Banken die Wirtschaft: nicht in Richtung dessen, was wir brauchen, sondern in Richtung dessen, was profitabel ist.
Um das zu ändern, brauchen wir zweierlei. Erstens, ein Kreditleitwerk – ein Regelwerk, das die Kreditvergabe der Banken weg von zerstörerischen Sektoren wie fossilen Brennstoffen und Luxusemissionen und hin zu sozial notwendigen Investitionen lenkt. Zweitens müssen wir die Rolle der öffentlichen Finanzen stärken. Der Staat muss direkt Geld schaffen, um lebenswichtige Güter und Dienstleistungen zu finanzieren – erneuerbare Energien, Wohnungsbau, öffentliche Verkehrsmittel –, auch wenn diese für das private Kapital nicht direkt profitabel sind.
Es gibt den Mythos, dass wir nur das produzieren können, was rentabel ist. Aber in Wirklichkeit können wir, solange wir die Arbeit und die Ressourcen haben, alles produzieren, was wir gemeinsam beschließen. Die einzige Barriere ist politischer Natur. Sobald wir die Geldschöpfung demokratisieren, können wir die Produktion vom Profitzwang befreien und sie nach menschlichen und ökologischen Bedürfnissen organisieren.
DK: Das leuchtet ein. Viele meiner linken Freunde in Europa argumentieren, dass der Euro das Haupthindernis ist. Sie plädieren für die Rückkehr zu nationalen Währungen, um die Souveränität zurückzugewinnen. Ich vertrete einen anderen Standpunkt: Wir sollten den Euro selbst demokratisieren. Das sind kleine, voneinander abhängige Staaten. Die Rückkehr zu nationalen Währungen birgt die Gefahr einer Spaltung und einer erneuten Abhängigkeit von externen Mächten wie den USA, die uns gegeneinander ausspielen werden. Was denken Sie?
Ich hege große Sympathie für dieses Argument. Ich verstehe den Reiz der monetären Souveränität durch nationale Währungen – sie bietet eine direktere Kontrolle über Produktion und Ausgaben. Aber sie zersplittert auch den Kampf. Wenn jedes Land der Eurozone eigenständig seinen eigenen Klassenkampf für die wirtschaftliche Transformation führen muss, wird der Fortschritt bestenfalls ungleichmäßig und verwundbar sein. Ein strategischerer Weg ist eine Neuregelung der Europäischen Zentralbank. Das könnte auf institutioneller Ebene schnell vonstatten gehen. Wir könnten den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre öffentlichen Investitionen sofort auszuweiten, indem wir die Sparmaßnahmen aussetzen.
Kritiker werden sagen, dass sie damit eine Inflation riskieren, und ja, wenn man einfach öffentliche Finanzmittel zuführt, ohne den Rest der Wirtschaft anzupassen, kann man die Nachfrage nach begrenzten Arbeitskräften und Ressourcen in die Höhe treiben. Aber eine ökosozialistische Wachstumsrücknahme (Degrowth) bietet eine Lösung: mit der Reduzierung der schädlichen und unnötigen Produktionen – SUVs, Kreuzfahrtschiffe, Privatjets – und der Umverteilung der Arbeit und Ressourcen auf sozial nützliche Aktivitäten. Dies stabilisiert die Preise und verändert die Struktur der Wirtschaft.
Die Inflation ist kein technisches Hindernis – sie ist ein politisches. Der wahre Grund für die Existenz von Austeritätsregeln besteht darin, Raum für eine ungebremste Akkumulation des Kapitals zu schaffen. Wenn wir produktive Ressourcen in Richtung öffentlicher Güter verlagern, bedrohen wir die Dominanz des Kapitals im System. Das ist es, was die Eliten zu verhindern versuchen, wenn sie sich auf Schuldenquoten und Defizitgrenzen berufen.
DK: Vor kurzem geschah etwas Seltsames. Trump sagte in Bezug auf die Inflation so etwas wie: „Statt 18 Barbie-Puppen werden eure Kinder zwei haben.“ Sein Argument war, dass wirtschaftliche Souveränität wichtiger sei als materieller Überfluss. Ich fand das aufregend – in gewisser Weise artikuliert er eine Art Anti-Konsum-Botschaft. Ist das nicht ein Teil der Gefahr des heutigen Faschismus? Es klingt anti-neoliberal, ist aber nicht anti-kapitalistisch.
Das ist genau richtig, und ich fand diesen Augenblick auch interessant. Einige Leute behaupteten sogar, Trump würde Degrowth befürworten, was völlig falsch ist. Degrowth ist eine grundlegend antikapitalistische Idee. Es bedeutet, die ökologisch zerstörerische und unnötige Produktion zu reduzieren und gleichzeitig öffentliche Güter, ökologische Regeneration und soziale Gerechtigkeit auszubauen. Trump tut nichts davon.
Aber es gibt etwas, das wir daraus lernen können. Er schaffte es, die Idee des materiellen Opfers – „weniger Barbie-Puppen“ – im Namen der Souveränität und des Nationalstolzes zu verkaufen. Das sagt uns etwas Wichtiges: Die Menschen sind bereit, Grenzen des Konsums zu akzeptieren, wenn diese in eine umfassendere, sinnvolle Vision eingebettet sind. Zu oft gehen wir Linken davon aus, dass die Menschen keinerlei materielle Einschränkungen akzeptieren werden. Aber das stimmt nicht. Was zählt, ist das Narrativ. Wenn wir den Menschen eine kohärente Vision von Freiheit, Würde, wirtschaftlicher Demokratie und einem bewohnbaren Planeten bieten, können wir für den Wandel eintreten. Die Herausforderung besteht darin, dieses Narrativ auf eine Weise zu gestalten, die emotional und moralisch überzeugend ist.
Natürlich müssen wir, damit Degrowth gerecht ist, sicherstellen, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Da kommt eine öffentliche Arbeitsplatzgarantie ins Spiel. Dies würde uns ermöglichen, Arbeit von schädlichen Sektoren in nützliche umzuleiten, mit menschenwürdigen Löhnen und Demokratie am Arbeitsplatz. Das ist der Unterschied zwischen einem ökosozialistischen Übergang und autoritärer Austerität.
MDS: Das bringt mich dazu, darüber nachzudenken, wie man eine wirklich demokratische sozialistische Alternative aufbauen kann. Vor allem im globalen Norden, wie überzeugen wir die Arbeiterklasse davon, dass diese Zukunft – die auf globaler Solidarität, Grenzen und Gerechtigkeit basiert – wie Sie gesagt haben, besser ist als das, was sie jetzt haben?
Das ist eine kritische Frage. Wir müssen den Menschen helfen zu verstehen, dass der Konsumreichtum im Norden auf ungleichem Tausch beruht – auf der Ausbeutung der Arbeitskraft und der Ressourcen des globalen Südens. Die Fast Fashion, die billige Elektronik, der häufige Austausch von Produkten – all das hängt von einem globalen System der Aneignung ab. Aber noch wichtiger ist, dass wir ihnen zeigen, dass die Arbeiterklasse im Norden unter diesem System eigentlich gar nicht gewinnt. Was sie an billigen Konsumgütern errungen haben, haben sie an politischer Handlungsfähigkeit, Autonomie und kollektiver Freiheit eingebüßt. Ihre Forderungen nach Dekommodifizierung, Demokratie am Arbeitsplatz und Kontrolle über die Produktion wurden aufgegeben.
Das Kapital hat billige Importe eingesetzt, um den Dissens der Arbeiterklasse zu befrieden und gleichzeitig seine eigene Macht zu festigen. Also ist der wahre Preis für die Arbeiter*innen nicht etwa ein weiteres iPhone – es sind Demokratie, Würde und eine lebenswerte Zukunft. Wir müssen diese Vision, die auf gemeinsamen Interessen mit dem globalen Süden beruht, neu entfachen. Der Schlüssel liegt darin, die ökosozialistische Transformation nicht als Verlust, sondern als Befreiung zu betrachten – von Ausbeutung, Prekarität und ökologischem Kollaps. Und genau hier wird Solidarität real: nicht Nächstenliebe, nicht Entwicklungshilfe, sondern der gemeinsame Kampf für eine bessere Welt.
MDS: Genau. Das ist die Spannung, die ich sehe. Die westlichen Eliten sind eindeutig die Hauptschuldigen des Imperialismus und der Umweltzerstörung. Aber in Ländern wie Norwegen profitiert die Arbeiterklasse auch materiell vom ungleichen Austausch – unser Wohlfahrtsstaat finanziert sich durch Erdölrenten, Billigimporte und globalen Extraktivismus. Wie fördern wir unter diesen Umständen die antiimperialistische Solidarität? Wie unterstützen wir revolutionären Wandel im Süden, während wir den Norden mobilisieren?
Das ist eine grundlegende und komplexe Herausforderung. Zunächst müssen wir erkennen, dass sich die Landschaft seit den 1960er Jahren verändert hat. Damals kamen viele Führungspersönlichkeiten des globalen Südens durch massenbasierte antikoloniale Bewegungen an die Macht. Sie hatten Mandate für die sozialistische Transformation. Aber im Laufe der Zeit wurden diese Bewegungen unterdrückt, vereinnahmt oder gestürzt – oft mit westlicher Unterstützung – und durch Kompradoreneliten ersetzt, die von der aktuellen imperialistischen Gestaltung profitieren. Diese Eliten sind nicht an Befreiung interessiert. Sie sind am globalen Kapital ausgerichtet, auch wenn ihre eigene Bevölkerung darunter leidet. Deshalb müssen sich die heutigen emanzipatorischen Bewegungen im Süden nicht nur mit dem westlichen Imperialismus, sondern auch mit ihren eigenen herrschenden Klassen im Inland auseinandersetzen.
Hier kommt die nationale Befreiung ins Spiel. Es geht nicht um Hilfe oder Entwicklung; es geht um politische Souveränität und kollektive Macht. Westliche Progressive müssen diese Bewegungen unterstützen – nicht aus Nächstenliebe, sondern aus Solidarität. Das bedeutet, mit der Logik des entwicklungsindustriellen Komplexes zu brechen und Revolutionen von der Basis zu unterstützen, die zum Ziel haben, die Kontrolle über Ressourcen, Produktion und Regierungsführung zurückzugewinnen. Sie haben Recht: Arbeiter*innen im Norden profitieren tatsächlich in gewisser Weise materiell. Aber sie sind auch zutiefst entmachtet. Sie haben billige Konsumgüter, aber keine demokratische Kontrolle über die Produktion. Das Kapital hat den ungleichen Tausch genutzt, um sich jegliche Forderungen nach Autonomie und Würde zu erkaufen. Also gewinnt die Arbeiterklasse nicht wirklich. Ihnen werden Illusionen von Wohlstand geboten, während ihre Grundrechte und Freiheiten erodieren.
Wir brauchen eine Doppelfrontstrategie. Im globalen Süden: nationale Befreiungsbewegungen, die neokoloniale Abhängigkeiten zerschlagen. Im globalen Norden: Bewegungen, die eine demokratische Kontrolle über die Produktion und Finanzen fordern. Beides zusammen ist der Weg, um den Kapitalismus zu beenden. Es ist nicht optional – es ist eine existenzielle Notwendigkeit.
DK: Das macht Sinn, wirft aber ein echtes Problem des politischen Timings auf. Wenn die nationale Befreiung im Süden die Werteströme bis zum Kern abschneidet, würde das gewiss zu Inflation, Knappheit und politische Gegenreaktionen führen. Werden die Bewegungen der Arbeiterklasse im Norden bereit sein, schnell genug zu reagieren – mit öffentlichen Investitionen, sozialem Schutz und einer neuen Vision? Oder wird die extreme Rechte zuerst dort sein?
Das ist die große Gefahr. Wenn wir uns nicht vorbereiten, könnten wir einen äußerst düsteren Ausgang erleben. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem der globale Süden beginnt, sich erfolgreich abzukoppeln – sei es durch Chinas „Belt and Road“-Initiative, regionale Handelsblöcke oder andere Mittel. Das unterbricht die Zuströme von billigen Arbeitskräften, Ressourcen und Profiten in den imperialen Kern. Plötzlich schrumpft der Verbrauch im Norden. Wenn die Linke keinen kohärenten postkapitalistischen Plan entwickelt hat, wird das Kapital handeln, um seine Dominanz zu erhalten. Und wie sieht das dann aus? Faschismus. Die Arbeit zu Hause wird zunichte gemacht, die Löhne im Inland werden gesenkt, jeglicher Dissens wird niedergeschlagen. Das ist meiner Meinung nach der Weg, auf den sich Trump vorbereitet – nicht, weil er einen klaren Plan hat, sondern weil die Logik des Niedergangs des Imperiums es erfordert.
Deshalb müssen wir einen echten alternativen Weg aufzeigen. Die gute Nachricht ist, dass wir die Daten haben. Die Forschung zeigt, dass wir den Lebensstandard im Norden mit viel geringerem Energie- und Ressourcenverbrauch aufrechterhalten oder sogar verbessern können. Aber das erfordert die Dekommodifizierung wichtiger Dienstleistungen – Wohnraum, Verkehr, Gesundheit, Bildung –, um die Menschen vor Inflation zu schützen und ihr Wohlergehen ohne Marktabhängigkeiten zu sichern. Das ist die Aufgabe der Linken: dafür zu sorgen, dass der Zusammenbruch des imperialen Konsums nicht zu einem Tor zum Autoritarismus wird, sondern zu einem Sprungbrett zur Demokratie und Befreiung.
DK: Damit sind wir bei einer zentralen Frage: der politischen Organisation. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Protest allein nicht mehr ausreicht. Wir haben in den letzten zehn Jahren enorme Mobilisierungen erlebt – Fridays for Future, Extinction Rebellion –, aber sie haben nicht zu wirklichen Veränderungen geführt. Was kommt als Nächstes?
Genau. Die Protestkultur des letzten Jahrzehnts war zwar unglaublich anregend, ist aber nun in einer Sackgasse. Massive Klimademonstrationen brachten Millionen auf die Straße. Für einen Moment fühlte es sich an, als müsste die politische Klasse reagieren. Aber das tat sie nicht. Es hat sich nichts Wesentliches geändert.
Wir befinden uns jetzt in einem Moment der Abrechnung. Die Menschen fühlen sich desillusioniert, weil sie erkennen, dass diese Aktionen nicht genügt haben. Die Energie verflüchtigt sich und das System bleibt intakt. Deshalb glaube ich, dass wir auf etwas zurückgreifen müssen, worüber viele bisher nur widerstrebend gesprochen haben: die Partei. Nicht die traditionellen Parteien, die innerhalb der Grenzen liberaler Institutionen operieren, sondern massenbasierte Parteien der Arbeiterklasse – Vehikel für den Aufbau echter Macht. Diese müssen in Gewerkschaften, Gemeinschaften und Volksorganisationen verwurzelt sein. Sie müssen mit interner Demokratie, aber auch mit strategischer Kohärenz arbeiten. Das könnte eine Rückkehr zu so etwas wie dem demokratischen Zentralismus bedeuten, der sich bei der Herbeiführung eines Strukturwandels als wirksamer erwiesen hat als der Horizontalismus.
FT: Das findet großen Widerhall. Viele von uns aus unserer Generation haben den Aufstieg und Fall der „Bewegung der Bewegungen“ miterlebt. Wir glaubten an den Horizontalismus – an Versammlungen, Autonomie, Konsens. Aber im Laufe der Zeit wurde klar, dass diese Formen nicht langlebig oder effektiv genug waren, um dem Kapital entgegenzutreten. Es war leicht, sie zu neutralisieren und zu unterdrücken. Jetzt stehen wir vor einer Krise der Massendemobilisierung, vor allem in der Arbeiterklasse. Nach Jahrzehnten neoliberaler Angriffe wurden Gewerkschaften und Arbeitsorganisationen ausgehöhlt oder vereinnahmt. Aber gleichzeitig sind die Versprechen einer Sozialdemokratie eindeutig tot. Das Kapital teilt nichts mehr mit den Arbeiter*innen. Das alte Geschäft ist also vorbei, und die große Frage lautet: Wie bauen wir wieder auf?
Das ist die Frage des Jahrhunderts, und sie beginnt mit Klarheit darüber, wofür die Arbeiter*innenbewegung kämpfen sollte. Im Moment sind viele Gewerkschaften in einer defensiven Haltung gefangen – sie versuchen, Arbeitsplätze zu erhalten, indem sie sich mit dem Kapital verbünden, in der Hoffnung, dass das Wachstum durchsickert und ihre Mitglieder über Wasser hält. Aber diese Logik ist eine Falle. Es ist ehrlich gesagt peinlich, dass die Gewerkschaften im Jahr 2025 das kapitalistische Wachstum immer noch als Lösung für die Prekarität der Arbeiterklasse sehen.
Wir müssen über die Kämpfe in den eigentlichen Betrieben für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen hinausgehen und die transformativen Ambitionen der Gewerkschaftsbewegung zurückbringen. Das bedeutet, für die Sicherung öffentlicher Arbeitsplätze, für universelle öffentliche Dienstleistungen, für eine demokratische Kontrolle der Produktion zu kämpfen. Die Gewerkschaften sollten an vorderster Front des ökologischen Wandels stehen und kein Hindernis dafür sein. Sie müssen mit der Logik des Kapitals brechen und sich an den breiteren Interessen der Menschheit und des Planeten ausrichten. Stellen Sie sich vor: Wir können Hunderttausende von Menschen für Lohnforderungen auf die Straße bringen. Aber warum nicht weiter gehen? Warum nicht die Dekommodifizierung der Hochschulbildung oder die Kontrolle der Arbeiter*innen über die Industrie fordern? Wir haben die Zahlen. Wir haben die Macht. Was wir brauchen, ist die politische Vision.
MDS: Ich möchte darauf aufbauen. Wenn wir es ernst meinen mit dem Wiederaufbau von Massenparteien, wie stellen wir dann sicher, dass sie internationalistisch ausgerichtet sind? Die extreme Rechte hat kein Problem damit, sich über Grenzen hinweg zu organisieren. Sie arbeiten zusammen. Sie entwickeln globale Strategien. Aber die Linke zieht sich oft in nationale Rahmen zurück – vor allem in Ländern wie Norwegen, wo sich die Menschen eher auf den Schutz des Wohlfahrtsstaates konzentrieren. Wie organisieren wir uns transnational, insbesondere über globale Lieferketten hinweg, wo der größte Teil der weltweiten Arbeitsausbeutung tatsächlich stattfindet?
Das ist ein entscheidender Punkt. Die politische Vorstellungskraft der Linken ist immer noch weitgehend durch den Nationalstaat begrenzt, aber das Kapital ist global. Lieferketten sind global. Der Faschismus ist zunehmend global. Unsere Antwort muss es auch sein.
Wir sollten uns entlang der Lieferketten organisieren – Streiks und Kampagnen nicht nur in einzelnen Ländern, sondern in allen koordinieren. Arbeiter*innen des globalen Südens, insbesondere Frauen in Fabriken und in der Landwirtschaft, sind das Rückgrat der Weltwirtschaft. Wenn wir die Solidarität zwischen ihnen und den Arbeiter*innen im Norden fördern – aufgrund gemeinsamer Probleme statt Mitleid oder Nächstenliebe –, können wir das System in seinem Kern sprengen. Stellen Sie sich die Macht koordinierter Aktionen über Produktionsknotenpunkte hinweg vor – von Bangladesch bis Deutschland, von Mexiko bis Norwegen. Das ist die Stufe der strategischen Vision, die wir entwickeln müssen. Das ist nicht nur möglich, es ist notwendig, und es beginnt mit dem Wiederaufbau internationalistischer Institutionen der Macht der Arbeiterklasse.
FT: Ja, und zum Abschluss: Unsere Bewegungen stehen vor einer großen Generationenfrage. Wir haben immer wieder erlebt, wie Wellen der Mobilisierung zusammenbrachen. Die alten Methoden funktionieren nicht mehr. Aber wie erschaffen wir die Organisierung unter den gegenwärtigen Bedingungen neu, wenn die Arbeiterklasse demobilisiert scheint und die Institutionen der Linken immer noch vom Liberalismus vereinnahmt sind?
Das stimmt. Wir haben einen langen Prozess der Orientierungslosigkeit hinter uns. Der neoliberale Angriff hat die organisatorische Infrastruktur der Arbeiterklasse demontiert – ihre Parteien, ihre Gewerkschaften, ihre Medienplattformen. Wir fangen also nicht bei null an, sondern wir beginnen von einer viel schwächeren Lage aus, und Sie haben Recht: Viele Institutionen, die noch existieren, stecken in einer defensiven Haltung fest. Sie klammern sich an sozialdemokratische Versprechen, die nicht mehr gelten. Das Kapital muss keine Kompromisse mehr eingehen. Es bietet der Arbeiterklasse nichts – nicht einmal Stabilität.
Die Herausforderung besteht im Wiederaufbau – und nicht nur zu reagieren. Wir brauchen ein neues organisatorisches Paradigma. Das bedeutet Klarheit, Disziplin, langfristige Vision. Es bedeutet, kompromisslos politisch zu sein. Und ja, es bedeutet wahrscheinlich eine Rückkehr zu Massenparteien – aber verwurzelt in den aktuellen Bedingungen, wobei wir sowohl aus den Stärken als auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen.
DK: Das erinnert mich an etwas aus einer früheren Generation. In den Niederlanden, in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren, hatten wir massive horizontale Hausbesetzerbewegungen – Zehntausende von Menschen, die bereit waren, auf die Straße zu gehen, Gebäude zu besetzen und sich physisch der Polizeirepression zu widersetzen. Sie waren revolutionär in der Energie, wenn auch nicht immer in der Strategie. Aber wir hatten keine Parteistruktur. Und schließlich reagierte der Staat mit brutaler Repression und einem parteiübergreifenden politischen Durchgreifen. Die Bewegung wurde zerschlagen, und innerhalb weniger Jahre wurden die Niederlande zu einer der ersten neoliberalen Demokratien des „dritten Weges“. Diese Geschichte ist eine Warnung.
Genau. Wir haben dieses Muster immer wieder gesehen. Der Horizontalismus ist großartig, um Menschen schnell zu mobilisieren und Momente radikaler Vorstellungskraft zu schaffen. Aber das reicht nicht. Wenn es hart auf hart kommt, wird er weggefegt. Wir brauchen dauerhafte Strukturen – Organisationen, die in der Lage sind, sich zu behaupten, Forderungen voranzutreiben und Macht zu übernehmen. Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, aber auch die Stärken der Vergangenheit zurückgewinnen. Organisation, Disziplin, Klarsicht – die sind nicht autoritär. Sie sind notwendig. Wenn wir keine Vehikel bauen, die den Kampf vorantreiben können, überlassen wir das Feld autoritären Reaktionen.
FT: Um noch einmal zum Anfang zurückzukehren, wir stehen wirklich an einem Scheideweg, nicht wahr? Wie Immanuel Wallerstein zu sagen pflegte, erreichen Weltsysteme schließlich Punkte, an denen sich ihre Wege teilen. Entweder finden wir einen Weg nach vorne durch Transformation, oder wir geraten in eine Spirale hin zu Fragmentierung, Unterdrückung und ökologischem Kollaps.
Genau. Das ist es, was diesen Moment so ernst macht. Auch wenn sich die extreme Rechte nicht ganz darüber im Klaren ist, worauf sie sich gerade vorbereitet, drängt uns die Logik des globalen Niedergangs in diese Richtung. Wenn der imperiale Kern den Zugang zu billigen Arbeitskräften und Ressourcen verliert, wird die herrschende Klasse darauf reagieren, indem sie sich nach innen wendet – die einheimische Arbeit zermalmt und die Gesellschaft militarisiert. Wir sehen dies bereits, und wenn die Linke keine Alternative anbietet – eine postkapitalistische Vision, die in Gerechtigkeit, Demokratie und ökologischer Stabilität verwurzelt ist –, dann wird das Kapital den Übergang mit Gewalt und Unterdrückung bewältigen.
Aber wir haben eine Chance. Wir wissen, dass menschliche Bedürfnisse mit drastisch weniger Energie- und Materialdurchsatz befriedigt werden können. Wir können universelle öffentliche Dienstleistungen aufbauen. Wir können die Preise ohne Wachstum stabilisieren. Wir können die Produktion so umorganisieren, dass sie dem Leben und nicht dem Profit dient. Das ist die Vision, für die wir kämpfen müssen. Nicht im Abstrakten, nicht eines Tages, sondern jetzt. Denn die Welt, in der wir leben könnten, ist immer noch möglich, aber sie entgleitet uns allmählich.